Der Freischütz
Romantische Oper in drei Aufzügen von Carl Maria von Weber (1786-1826)
Libretto von Johann Friedrich Kind
In deutscher Sprache mit deutscher und englischer Übertitelung. Dauer 2 Std. 50 Min. inkl. Pause nach dem 1. Teil nach ca. 1 Std. 35 Min. Werkeinführung jeweils 45 Min. vor Vorstellungsbeginn.
Gut zu wissen
Gespräch

Sechse treffen, sieben äffen!
In Webers «Freischütz» hat der Teufel seine Hand im Spiel, und der Regisseur darf sich von ihm nicht einschüchtern lassen. Ein Gespräch mit Herbert Fritsch vor der Premiere 2016 über die diabolische Herausforderung, den «Freischütz» zugleich als farbenfrohe Choroper, burleskes Volkstheater und furchterregendes Schauerdrama auf die Bühne zu bringen.
Herbert, wovon handelt der Freischütz?
Ein grosses Thema ist die Angst des Mannes vor der Frau. Die Angst, sich einer Frau gegenüber klein und ohnmächtig zu fühlen und dann nach Hilfe zu suchen, und diese Hilfe nicht zu bekommen und daran kaputt zu gehen. So ergeht es Max. Das ist ja ein sehr heutiges Thema: Was heisst Mann sein? Was heisst stark sein? Was bedeutet es, keinen Erfolg zu haben als Mann, plötzlich immer daneben zu treffen und zu versagen?
Der Misserfolg von Max bezieht sich aber im Freischütz nicht nur auf die Beziehung zu Agathe, sondern auch auf die Gesellschaft insgesamt, der er sich gegenübersieht. Die ist engstirnig und übt einen extremen Erwartungs- und Konformitätsdruck auf ihn aus.
Absolut. Max muss alles an einem bestimmten Tag richtig machen. Er muss treffen. Das ist übrigens auch der Druck, unter dem ich als Regisseur stehe. Der Freischütz ist so bekannt und schon so oft gemacht worden, und es ist schwer, diesem Stück gerecht zu werden. Plötzlich spürst du als Regisseur die gleiche Versagensangst wie Max. Eine stärkere Identifikation zwischen dem Regisseur und seiner Hauptfigur kann es gar nicht geben. Du bist umstellt von Erwartungen, die dich wie finstere Geister umgarnen. Und dann sollst du diesen unglaublichen Schuss machen. Wahnsinn.
Kannst du die Situation von Max noch etwas genauer beschreiben?
Er hat kein Vertrauen mehr, in nichts und niemanden. Man sagt ja, dass Vertrauen die Überwindung von Komplexität ist. Das ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt, auch beim Regieführen. Wenn Vertrauen da ist, kannst du die Dinge geschehen lassen. Aber Max ist überall mit Komplexität konfrontiert. Stärkster Ausdruck davon ist Kaspar, der macht das alles noch schwieriger und undurchschaubarer, als es eh schon ist. Und Max fällt auf diese Komplexität rein anstatt zu sagen: Es ist, wie es ist. Ich schiesse jetzt halt mal und dann schauen wir weiter. Das schafft er nicht. Er hat auch das Vertrauen in sich selbst verloren. Er ist total allein. Furchtbar, diese Einsamkeit, der er ausgesetzt ist.
Du sagst, als Regisseur kennst du die Versagensängste von Max. Was ist deine Strategie dagegen?
Es gibt einen Heiligen, Josef von Copertino, er ist der Schutzpatron der Prüflinge. Er wird auch der heilige Einfaltspinsel genannt. Der ist ein grosses Vorbild für mich. Den haben im Kloster alle für den totalen Deppen gehalten, deshalb durfte er nicht zur Priesterprüfung. Er wollte es aber unbedingt. Mit Riesenschritten – Forrest Gump hat da seinen Ursprung – rennt er nach Bologna. Gerade noch rechtzeitig kommt er zur Prüfung. Die Kardinäle stellen ihm eine hochkomplexe theologische Frage. Josef von Copertino denkt lange nach und sagt dann einfach nur: «Amen!» Die Kardinäle sind völlig perplex, finden aber, dass das genau die richtige Antwort sei. Sie stellen die zweite Frage, wieder sagt Josef: «Amen». Die dritte Frage, wieder: «Amen». Er hat die Priesterprüfung bestanden. Das war der heilige Josef von Copertino.
Max wendet sich am Punkt grösstmöglicher Verzweiflung dem Dämonischen zu. Er geht in die Wolfsschlucht. Findest du, dass das Unheimliche immer noch eine wirksame Kraft ist, oder ist das nur schwarze Märchenromantik aus dem 19. Jahrhundert?
Nein, das ist Realität! Wir kennen doch alle Situationen, in denen wir das Unheimliche spüren. Du stehst auf einem hohen Felsen, guckst in die Tiefe und spürst plötzlich diesen Sog, der dich nach unten zieht und musst ganz schnell weggehen, damit du dem Zwang nicht erliegst, dich vornüber zu beugen. Manche Menschen sind von Kriminalität fasziniert. Ihnen geht es nicht darum, Leuten Geld abzuluchsen, sondern sie fühlen sich von dem Unheimlichen angezogen, der Verlockung, die dem Kriminellen innewohnt. Oder der Abgrund der Depression: Alles finster zu sehen, alles schwarz zu malen, kann einen unglaublichen Sog entwickeln, der einen immer weiter in die Tiefe zieht. Irgendwann fängst du an, die Schwärze auszukosten und dich in der Negation zu suhlen. Im Freischütz steckt das alles drin.
Und wie bringt man das Unheimliche auf die Bühne? Im Stück hat es ja seine Erscheinungsform in Gestalt von Samiel, dem Teufel. Zu Carl Maria von Webers Zeiten war das eine furchterregende Figur. Kann man ihn heute nur noch als Witzfigur auf die Bühne bringen?
Nein, überhaupt nicht. Es kommt ja auch immer darauf an, was Witz beinhaltet. Clowns können sehr böse sein. Der Arlecchino aus der Commedia dell’arte kann bestialisch lachen und hat in seiner Maske noch die Reste der Teufelshörner an der Stirn. Das vermeintlich Witzige kann sehr unheimlich sein. Aber der Witz hilft uns, in Distanz zu kommen zum Bösen. Ich finde, man darf den Zuschauern das Teuflische nicht distanzlos um die Ohren hauen wie in den humorlos aufgedonnerten Horrorfilmen.
Der Witz verleiht dem Teufel Souveränität.
Genau. Das beste Beispiel ist Mephisto. Fragst du einen Schauspieler, ob er lieber Faust oder Mephisto spielen will, wird er immer Mephisto wählen. Der sahnt nämlich ab beim Publikum. Ich selbst habe auf dem Theater immer gerne die abgefeimten, bösen Typen gespielt. Das stachelt die Schauspielerlust an. Ich kann es gar nicht genau erklären, worin die Faszination solcher Figuren liegt. Über Harlekine mit richtig bösem Humor haben die Leute geschrien vor Lachen, aber sie mussten auch damit rechnen, hingerichtet zu werden. Und die Teufelsdarsteller wurden nicht auf dem Friedhof begraben, sondern dahinter.
Der Freischütz ist ein aufwendiges Ausstattungsstück. Da gibt es Jäger, Gewehre, heruntergeschossene Adler, von der Wand fallende Ahnengemälde, Wolfsschluchtfelsen usw. Wie gehst du damit um?
Ich räume das alles ab. Nicht nur im Freischütz, sondern immer in meinem Theater. Ich finde, dass man sich frei machen sollte von diesem ganzen Ballast, gerade in der Oper. Für mich ist der Sänger oder der Schauspieler der Mittelpunkt des Theaters. Er muss mit Energie aufgeladen sein, er muss Funken schlagen und nicht die FeuerwaffenAbteilung. Für mich ist das die Grundsituation: Ein Darsteller singt oder erzählt eine Geschichte mit solcher Spannung und Konzentration, dass ich alles leibhaftig vor mir sehe. Dazu brauche ich keine Requisiten. Aus der Einfachheit des Theaters erwächst die Magie! Das ist ja gerade der Trick im Theater, dass die Zuschauer auf der Bühne Dinge sehen, die gar nicht passieren. Und davon handelt ja auch der Freischütz, insbesondere in der Wolfsschlucht.
Was heisst das konkret, wenn etwa im Freischütz geschossen wird und es keine Gewehre gibt?
Der ganze Chor schreit «Peng!».
So einfach, wie du sagst, ist dein Theater aber gar nicht. Was du auf die Bühne bringst, lebt auch von der Lust am Verschwenderischen: Du liebst die grosse Körpergeste, spektakuläre Artistik, übertriebene Aussprache, opulente Kostüme.
Immer wenn ich die Körper in einen Zustand des Überschwangs bringe, wenn Energie vergeudet wird, entsteht etwas Spannendes. Die Schauspieler sagen manchmal zu mir: Herbert, wenn wir die ganze Zeit mit dieser extrem hochgefahrenen Energie spielen, können wir am Ende nicht mehr. Ich sage aber: Wenn das Herz offen ist und man voll in den Wahnwitz geht, wird man am Ende noch viel mehr Energie haben als vorher. Da bauen sich grosse Glücksmomente auf, weil man spürt, wozu der Körper fähig ist, wie er strahlen kann. Ich bin total begeistert von den Solisten und dem Chor hier in Zürich, von der Kraft und der Lust und der Offenheit, mit der sich alle in die Arbeit schmeissen. Ich versuche immer die Trennung zwischen Musik und Schauspieldramatik aufzuheben. Von meinen Schauspielern erwarte ich, dass sie singen, wenn sie sprechen, und tanzen, wenn sie sich bewegen, und bei den Sängern umgekehrt. Wir haben hier viele Sänger im Ensemble, die Deutsch nicht als Muttersprache gelernt haben, was im deutschen Singspiel oft als Problem empfunden wird. Ich finde es aber gerade interessant, eine Norwegerin, einen Engländer, eine Französin, einen Bulgaren und einen Russen deutsche Dialoge sprechen zu lassen. Ich bin voller Respekt, mit wieviel Leidenschaft sie sich den Texten widmen, und geniesse es, dass sie mit starkem Akzent sprechen. Sie bringen dadurch unglaublich viel an Persönlichkeit ein. Natürlich nehme ich sie streng in die Pflicht, was Aussprache, Betonung usw. angeht, aber da entsteht eine grosse Energie. Ist das nicht auch eine Form der viel beschworenen Integration, um mal einen Modebegriff der Gegenwart ins Feld zu führen? Im Schauspiel wird ständig über migrantisches Theater diskutiert, in der Oper ist das selbstverständlich.
Du propagierst ein direktes, umstandsloses Theater, das die Dinge gerne Karl-Valentinhaft beim Wort nimmt. Das aber wird als sehr künstlich wahrgenommen. Wie ist das zu erklären?
Ich hatte mal ein Schlüsselerlebnis, als ich die Traviata-Aufnahme aus der Scala mit der Callas und Di Stefano gehört habe. Da war ich an einer hochdramatischen Stelle regelrecht geschockt vor Ergriffenheit, als ob ich einen Verkehrsunfall erlebt hätte. Als ich die Aufnahme dann noch einmal mit Distanz gehört habe, ist mir klar geworden: Die Emotionen sind total gespielt, hergestellt, künstlich. Von da an wusste ich, dass das ganze methodacting, der vermeintliche Realismus, der aus tiefer emotionaler Einfühlung erwachsen soll, völlig ballaballa ist. Durch rein mechanische Vorgänge, die man ganz präzise und am besten übertrieben ausführt, entsteht wesentlich mehr. Ist es Realismus, wenn sich ein Schauspieler auf der Bühne eine Zigarette anzündet, ein Bier trinkt und dabei einen Monolog spricht, oder ist es realistischer, wenn einer den Text ganz bewusst in einer falschen, künstlichen Tonlage spricht? Es gibt ja diese typischen Situationen an den Schauspielschulen: Der Schüler macht etwas Ungelenkes, und der Lehrer sagt: Das glaube ich dir jetzt nicht. Furchtbar. Anstatt dass man aus der interessanten Verrenkung etwas entwickelt! Das Theater ist künstlich. Ich kann die Worte «ehrlich» und «bescheiden» im Zusammenhang mit dem Theater nicht hören! Wir sind doch auf der Bühne und nicht im Kloster! Und wir sind nicht ehrlich. Die Leute dürfen ruhig wissen, dass sie im Theater reingelegt werden. Theater ist Betrug! Wie Nietzsche in Jenseits von Gut und Böse sagt: Warum soll es immer um die Wahrheit gehen, warum nicht um die Unwahrheit? Die Leute sind von der Unwahrheit fasziniert, nicht von der Wahrheit. Theater lebt von der Verarschung. Wenn ich hinter die Bühne gehe, sehe ich ein Kulissenteil, auf dem «Wolfsschlucht» steht.
Manche Leute glauben, du würdest dich lustig machen über die Stücke. Das ist aber gar nicht so. Nimmst du dieses Missverständnis in Kauf?
Das muss ich. Ich kann den Zuschauern ja nicht vorschreiben, wie sie meine Stücke wahrzunehmen haben. Natürlich kenne ich das: Es gibt Leute, die unterstellen mir, ich würde puren «Klamauk» machen, und meine Bühnen sind nicht farbig, sondern «quietschbunt». Warum werden die Werke der modernen bildenden Kunst nie als quietschbunt beschrieben? Weil im Kontext von Theater immer noch Kategorien wie Wahrhaftigkeit und Bescheidenheit ins Feld geführt werden. Dann wird es natürlich schwierig, wenn man etwas Knalliges macht und Sachen überbetont. Das ist dann gleich eine Karikatur, und es wird gar nicht wahrgenommen, dass es zunächst Gestaltung ist, bewusste, klar gesetzte Gestaltung. Es ist der Versuch, das Gewöhnliche hinter sich zu lassen und in eine andere Welt vorzudringen.
In deiner King Arthur-Inszenierung hier am Opernhaus gab es in der Premiere einen Zwischenruf. Einer hat vom Rang gebrüllt: «Geht’s auch mit Niveau?» Was hat sich deiner Meinung nach da Luft verschafft?
Jeder hat einen anderen Begriff von Niveau, und der Zwischenrufer fand, dass sein Begriff missachtet wurde. Ich kann das nachvollziehen. Über der Oper liegt viel mehr noch als über dem Schauspiel eine Aura des Andächtigen mit diesen vielen eingespielten Ritualen. Die Kunst wird mit heiligem Ernst zelebriert, und – seien wir ehrlich – dieser Ernst überspielt manchmal auch eine gewisse Routine. Wenn man das mit Fratzenschneiden unterläuft, wird es als niveaulos empfunden. Die Konventionen zu stören, hat aber auch eine Qualität, man könnte auch sagen: Niveau. Aber halt ein anderes. Störung ist in unserer Welt nicht erwünscht. In unserer allgemeinen Coolness wird es als übertrieben und niveaulos empfunden, wenn einer zu zappeln anfängt. Bloss nicht ausrasten im Supermarkt, weil wieder mal nur eine Kasse besetzt ist! Immer blank face. Warum?
Womit wir wieder beim Freischütz wären: Auch Max soll immer schön in der Spur laufen und sich in die Realität der wohlgeordneten Försterwelt fügen.
Und genau das macht ihn kaputt. Im Freischütz ist die Frage nach der Realität ein ganz wichtiges Thema. Das Auge, das für den Jäger so wichtige Sinnesorgan, wird ständig getäuscht. Was ist Realität für Max? Für Agathe? Für Kaspar? Für uns? Und wer bestimmt eigentlich die Realität da draussen in der Welt? Wenn ich aus dem Fenster gucke, sehe ich Sachen, die ich nicht möchte. Also ist das nicht meine Realität. Ich will aber meine Realität!
Als Künstler hast du das Privileg, dir auf der Bühne deine eigene Realität zu schaffen.
Ich finde, jeder sollte sich seine eigene Realität schaffen.
Das Gespräch führte Claus Spahn.
Foto von Sabrina Zwach.
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 41, September 2016.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Essay
Das Grauen und das Lachen
In der Wolfsschlucht des «Freischütz» herrscht das Grauen. Aber wo das Grauen herrscht, ist auch das Lachen nicht weit. Denn Grauenhaftes kann lachhaft sein und Lachen grauenerregend. Sie sind Gegensätze und gehören doch zusammen: Eine kleine Dämonologie des Grauens und des Lachens und wie sie vielleicht zusammenhängen.
Vor langer, langer Zeit lebte in den Menschen ein Dämon. Er war fest eingeschlossen und hielt sich ruhig, bis zu jenem verhängnisvollen Tag, an dem die Menschen glaubten, vom Baum der Erkenntnis essen zu müssen. Keine gute Idee. Ein schlecht gelaunter Kerl mit einem Flammenschwert trieb sie hinaus, damit sie Fleiss und Industrie entfalteten, Kapital und Arbeit, und jede Menge Ärger mit der Rollenverteilung. Aber das war noch nicht das Schlimmste. Das Schlimmste war, dass sich der eingeschlossene Dämon befreite. Wie konnte er das? Indem er sich teilte. Was einst ein umfassendes und mehr oder weniger schlummerndes Wesen war, das wurde nun zwei. Der eine Dämon nannte sich: Das Lachen. Der andere: Das Grauen. Das Lachen und Das Grauen wussten natürlich, dass sie ursprünglich ein einziges, richtig geiles Dämonendings gewesen waren, und dass sie das nie wieder werden würden. Das machte sie ganz wild. Unglücklich. Deprimiert. Zornig. Und böse. Vor allem böse.
Das Lachen und das Grauen wussten nicht, ob es besser wäre, sich irgendwann wieder zu vereinen, oder wenn einer den anderen verjagen würde. Wenn das Lachen die Menschen schüttelt, soll das Grauen verjagt sein. Und wenn das Grauen sie packt, soll für das Lachen kein Platz sein. Geklappt hat natürlich weder das eine noch das andere. Die Nachkommen von Adam und Eva nannten dies «das unglückliche Bewusstsein». Es wurden viele kluge Bücher darüber geschrieben, aber die Fragen waren nicht zu beantworten: Sollen wir über die Welt lachen oder uns vor ihr grauen? Soll ich über mich selbst lachen oder soll es mir vor mir selber grauen? Soll es mir vor mir selbst grauen, damit ich über die Welt lachen kann? Oder soll es mir vor der Welt grauen, damit ich über mich selbst lachen kann? Schon die Grammatik wird zum Problem. Und weil die Grammatik von Grauen und Lachen nie einen vernünftigen Aussagesatz zu bilden imstande war, suchte man sich parallele Dinge, Wesen und Welten, auf die man die verdammten zwei Dämonen loslassen konnte: Götter, Karneval, Opern… Seitdem ist immer was los, wenn es um das Lachen und um das Grauen geht. Nur mit der Erlösung will und will es nicht klappen.
––
Es gibt jede Menge Modelle, das vielleicht verbreitetste (und leider auch trivialste) lautet: Das Grauen ist das Problem, und das Lachen ist die Antwort. Es gibt ein Ich, das dem Grauen das Lachen gegenüber stellt. Dann haben wir entweder einen lachenden Helden, oder einen Helden, der einen Lachen-Macher bei sich hat. Das Böse will den Helden Angst machen. Da Helden vor beinahe nichts Angst haben, muss es schon das Grauen sein. Das Grauen hat drei Ursachen: Das, wovor man Angst hat, ist nicht von dieser Welt (Himmel und Hölle brechen herein). Das, wovor man Angst hat, übersteigt das menschliche Mass (Können dies wirklich Menschen anderen Menschen antun?). Das, wovor man Angst hat, ist selbstwidersprüchlich (Wurde jener zum Schlächter, gerade weil er den Menschen Gutes bringen wollte? Ist jener Mensch, den ich am meisten begehrte, der, den ich am meisten fürchten muss?).
Dummerweise aber steckt in der Verkörperung des Grauens (die immer eine Abmilderung ist, denn das eigentliche, das richtige Grauen hat kein Bild und keinen Namen) immer auch wieder das Lachen. Entweder lacht das Monster – es tendiert dazu, schrill, laut und unaufhörlich zu lachen –, oder es ist selbst zum Lachen. Der Killerclown ist eine aktuell beliebte Figur des lachenden Grauens.
Natürlich verhält es sich auch andersherum. Was treibt einen lachenden Helden denn in der Welt herum? Warum bestellt er nicht seine Felder und liest am Abend die Zeitung? Warum sucht er die Gefahr, die ihn zum Lachen bringt? Genau. Weil ihn das Grauen treibt. Weil ein Held das Grauen lieber vor sich hat als in sich. Klar, dass wir von hier aus ein dialektisches Modell entwickeln: Grauen und Lachen überwinden einander, indem sie sich aufheben. Sie bezwingen einander nur, indem sie sich perpetuieren. Man mag zudem nach einem Umschlagpunkt suchen: Wer einfach nicht mehr aufhören kann zu lachen, erregt Grauen. Wer so viel Grauen akkumuliert, dass ihn nicht einmal die Götter beruhigen können, muss lachen.
––
Grauen und Lachen entstehen aus dem Mythos und sind subjektive Empfindungen. Das eine hat mit dem anderen zu tun. Ich könnte mein Grauen nicht benennen, wenn es dafür nicht Vorbilder gäbe. Ist dies nicht ein grauenvoller Zusammenhang? Mir graut, weil anderen schon vor mir gegraut hat. Lachen und Grauen sind nicht nur in Mythos und Subjekt verborgen, sondern es sind auch Kulturtechniken. Es gibt ein Lachen, das verbindet, und eines, das trennt. Ein Friedenslachen und ein Kriegslachen. Es gibt ein Grauen, mit dem man allein nicht zurechtkommt, und ein anderes, das wohlige Schauer macht. Zeit, das Lagerfeuer zu entzünden. Und grausige Geschichten zu erzählen.
Lachen und Grauen sind da, schon länger als es Menschen gibt, wie wir sie kennen; Lachen und Grauen sind in jedem Menschen; Lachen und Grauen müssen aber auch gelernt werden. Wer darf wann und unter welchen Umständen über etwas lachen? Und wer darf sich wann und unter welchen Umständen vor etwas grauen? Lachen und Grauen müssen kontrolliert werden. «Erwachsen» und «frei» ist, wer Lachen und Grauen kontrollieren kann. Weil niemand je wirklich erwachsen und frei wird, müssen wir («die Gesellschaft», «der Staat») ein wenig nachhelfen. Eine Gemeinschaft besteht aus Menschen, die miteinander lachen und sich miteinander grauen. Eine Gesellschaft muss mehrere Lachkulturen und mehrere Kulturen des Grauens in sich vereinen. Leicht ist das nicht.
––
Lachen und Grauen haben die selben Ursachen, meistens. Etwas ist nicht, was es scheint. Etwas ist undeutlich und uneins, nicht gestern und nicht heute, nicht da und nicht fort, nicht gesagt und nicht beschwiegen, nicht Bild und nicht Zeichen. Etwas, das ganz sein sollte, ist nur in Teilen da (Splatter) und etwas, das in Teilen funktionieren sollte, tut es als Ganzes nicht (Slapstick). Lachen und Grauen erheben sich, wo die Sinnsysteme Lücken aufweisen. Sie treten auf, wo Menschen mit grössten Mühen Sinn herzustellen versuchen. Alle Menschen, deren Beruf es ist, Sinn herzustellen, gibt es in einer lächerlichen und in einer grauenhaften Variante.
Das Böse versucht, das Zerbrochene von Lachen und Grauen auf seine Weise wieder herzustellen. Es bastelt, wo Götter schöpfen. Aber meistens ist es nicht so einfach. Das Grauen im Herz der Finsternis ist so jedenfalls nicht zu erklären. Na klar! Das Verdrängte! Lassen Sie mich doch in Ruhe mit dem Verdrängten. Da lache ich doch. Da graust es mir. Der kluge Mann mit der Couch aus Wien hat freilich auch nur einen neuen Begriff für den Ort gefunden, an dem sich Grauen und Lachen im Geheimen verabreden, um zu sehen, ob sie es nicht doch noch einmal miteinander versuchen.
––
Es ist vernünftig, das Grauen und das Lachen ernst zu nehmen. Das fällt uns zunehmend schwer. Es ist einfach zuviel von dieser «Ironie» unterwegs. Es gibt Leute, die glauben, dass man das Lachen und das Grauen in Ironie auflösen könnte. Als könnte man über das lachen, worüber man lachen soll. Lachzwang für die niederen Stände! Ironie für die kulturell Bessergestellten! Nein, sagen die beiden Dämonen (sie sind sich eben dann doch in vielem einig), so wird das nichts! Wir lassen uns von euch keinen dritten Dämon aufschwatzen, dieses Dämönchen namens Ironie verspeisen wir bei der kleinsten Krise, ihr postmodernen Heuchler. Weil es nämlich keineswegs so ist, dass das, worüber man lacht, etwas ist, das man nicht ernst nimmt. Mit solchen Rationalisierungen kommt man den Dämonen nun wirklich nicht bei. Das Grauen liegt jenseits der Angst, und das Lachen liegt jenseits der Lust.
––
Das Lachen will hinaus. Es explodiert und steckt an. Es ist, sagt man, einem Orgasmus verwandt. Gott, wie peinlich! Das Lachen verrät einen ja immer, hören Sie sich doch dieses hysterische Gekicher der Weiber an, oder das dumpfe männerbündische Höhöhö. Da lache ich doch lieber gleich gar nicht, wenn Lachen einen so entblösst.
Das Grauen will hinein. Es implodiert und macht einen stumm. Es ist, sagt man, einem Tod verwandt. Hölle, wie schrecklich! Das Grauen verrät einen ja immer, sehen Sie dieses Kreischen vor der Maus, diese Angst vor der Mutter. Das Grauen zersetzt den Körper.
Im Lachen spielt das Es, im Grauen das Über-Ich verrückt. Vielleicht ist es auch umgekehrt. Jedenfalls wird Lachen leicht Musik, und Grauen wird leicht Text. Während sich also im Vordergrund auf der Bühne Lust und Angst begegnen, balgen sich im Hintergrund Lachen und Grauen. (Auch das kann man natürlich einmal herumzudrehen versuchen.) Kein Wunder, dass die Katastrophe auf der Bühne als Erlösung gesehen wird. Erst einmal. Das Happy End von Lachen und Grauen ist meistens fad. Oder es ist eigentlich gar keines. Denn dies ist der Stand des unglücklichen Bewusstseins: Dass der Mensch dringend sein Lachen und sein Grauen zusammenbringen muss. Und dass dabei fast nie etwas Gescheites herauskommt. Es sei denn, dieses Bewusstsein wäre seines eigenen Unglücks, nun ja, bewusst. So entsteht die Poesie des Lachens. So entsteht die Poesie des Grauens. So entsteht die Poesie der unversöhnbaren Einheit von Lachen und Grauen.
––
Die Verteilung von Lachen und Grauen ist auch eine Frage der Macht. Das Lachen den Mächtigen, das Grauen den Ohnmächtigen, so hätten sie es gern. Das Lachen wie das Grauen sind auch als Waffen zu gebrauchen. Leute, die gelernt haben, die beiden Dämonen als Kulturtechniken zu domestizieren, konnten auch lernen, dass sich in Lachen und Grauen Machtverhältnisse abbilden lassen. Das geht auf sehr einfache Weise, im Lachen über des Kaisers neue Kleider, oder im Grauen vor dem Vampir, der eigentlich die rachsüchtige Wiederkehr des entmachteten Fürsten ist. Aber es wird immer komplizierter, je feiner man die Waffen justiert. Wenn man sie beide in Bezug miteinander einsetzt, bekommt der gespaltene Dämon einen neuen Namen. Er heisst jetzt: Kritik.
––
Aber vergesst die Gefühle nicht. Und vergesst die Körper nicht! Ist es nicht so, dass man sich beides mal, im Lachen wie im Grauen, «angefasst» fühlt? Etwas Körperloses greift nach dem Körper: es streicht über die Oberfläche, es piekst, es kitzelt, es reisst. Der Körper kann nicht einer bleiben unter dem Anfassen dieser Dämonen. Er macht die Spaltung der Dämonen nach. Was lacht und was graut, will sich lösen. So muss aus dem Lachen wie aus dem Grauen jeweils ein Genre werden. Im Genre sind diese drei Dinge, der Mythos, die Wahrnehmung, der Körper, aufgehoben; auf eine Poetik von Lachen und Grauen folgt eine Semantik. Wir können das Lachen nicht und nicht das Grauen vollständig kontrollieren und «kultivieren». Aber mit den Zeichen des Lachens und mit den Zeichen des Grauens ist das etwas anderes. Ja, so müsste es gehen: Das Lachen und das Grauen werden an die semantische Leine des Genres genommen. Da weiss man, was man darf, was man soll, was einen erwartet. Und dass man immer wieder zurück kann.
Denn Lachen und Grauen sind immer auch epidemisch. Sie wollen sich in der Zeit ausdehnen. Man kann einfach nicht aufhören zu lachen und sich zu grausen. Es ist mächtiger als ich. Es überkommt mich. Es ergreift Besitz von mir.
Es ist die Frage, ob die Androiden, Roboter, Postmenschen nicht lachen und nicht sich grausen dürfen, oder ob sie beides lernen müssen, um wirklich die Geschichte der Menschen fortsetzen zu können. Algorithmen lachen nicht. Drohnen graust vor nichts. Daran müssen wir noch arbeiten. Am Tag, als der paranoide Androide zum ersten Mal schallend lachte, begann es ihn vor seiner Zukunft dermassen zu gruseln, dass er den Selbstzerstörungsmechanismus aktivierte. Tricky, nicht wahr? Es bedeutet: Das Grauen und das Lachen gehören zum Menschen; sie machen ihn erst dazu. Wir sind in unserer Geschichte durch Lachen und Grauen verbunden. In Bruch und Kontinuität.
Text von Georg Seesslen.
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 41, September 2016.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Meine Rolle

Die erste deutschsprachige Partie, die ich studiert habe, war Pamina in Mozarts Zauberflöte. Allerdings hatte ich in den USA, wo ich herkomme und Gesang studiert habe, leider keinen Deutschunterricht. Bei meinen Anfängen im deutschen Opernfach habe ich also nur die korrekte Aussprache gelernt. Das hat sich glücklicherweise geändert, als ich Ensemblemitglied an der Deutschen Oper Berlin geworden bin: Dank einer älteren Dame, bei der ich am Anfang wohnte, und sehr geduldigen Freunden, habe ich angefangen, auch im Alltag Deutsch zu sprechen. Beim Einstudieren von grossen Strauss- oder Wagner-Partien kommt mir diese Erfahrung heute sehr zugute.
Das Beherrschen von verschiedenen Sprachen ist für uns Sängerinnen und Sänger immer wieder eine Herausforderung und wirkt sich natürlich auf die Qualität der Aufführungen aus. Meine erste Agathe habe ich diesbezüglich in einer etwas seltsamen Konstellation gesungen: Es war eine Freischütz-Inszenierung in der südfranzösischen Stadt Toulon. Richtig gut Deutsch gesprochen hat im Team eigentlich niemand, und das war – obwohl wir eine schöne Zeit hatten – für diese Oper nicht immer ganz leicht…
In der Zwischenzeit habe ich wichtige Erfahrungen im deutschsprachigen Fach gemacht, darunter auch in der Schweiz, wo ich in St. Gallen Beethovens Leonore zum ersten Mal gesungen habe, oder in Salzburg, wo nach der Eva in den Meistersingern nun die erste Elsa im Lohengrin ansteht. Natürlich ist es mir wichtig, auch italienische Partien zu pflegen, von Mozart etwa oder Händel, aber Rollen wie beispielsweise Arabella oder die Marschallin von Strauss liegen mir schon ganz besonders am Herzen. Oder Euryanthe, eine andere und viel weniger bekannte Partie von Weber… Ich habe sie gerade erst am Theater an der Wien für mich entdeckt – wunderbar!
Ich glaube, an den beiden Partien von Weber gefällt mir ganz besonders, dass sie trotz aller Schwierigkeiten und dramatischer Momente auch immer sehr lyrisch bleiben. Das liegt mir. Und dann ist da natürlich der charakterliche Aspekt der Reinheit, der Hoffnung und Willensstärke, der für so viele deutsche Sopranpartien bestimmend ist – auch für Agathe: Sie wartet beharrlich und geduldig auf die Hochzeit mit dem Jäger Max, von der sie sich viel verspricht. Max, der sich vor der Hochzeit durch einen Probeschuss beweisen muss, ist aber nervös und verunsichert. Er ist Agathe also keine Stütze. Sie findet ihre ganze Kraft und Zuversicht daher in ihrem tiefen Glauben, der in der berühmten Arie «Leise, leise, fromme Weise» besonders deutlich zum Ausdruck kommt.
Agathes Gläubigkeit hat aber auch eine andere Seite: sie ist nämlich auch schrecklich abergläubisch. In jedem ungewöhnlichen Ereignis, sei es auch noch so klein, sieht sie immer gleich ein böses Omen. Und dieser Hang zum Pessimismus ist so stark, dass ihre schlimmen Träume und Ahnungen schliesslich wirklich wahr werden: Am Ende geht Max’ Schuss daneben, und alles was bleibt, ist die Hoffnung auf eine vertagte Hochzeit. Aus diesem Grund gefallen mir die Szenen mit Agathes Vertrauter Ännchen besonders gut: Ännchen ist das pure Gegenteil von Agathe und versucht stets, sie mit ihrer optimistischen und humorvollen Art zu ermuntern.
Abergläubischen Ängsten und schlechten Träumen bin ich selbst natürlich auch schon begegnet. Jede Künstlerin, jeder Künstler kennt das ... Aber am Ende ist die Hoffnung meist doch die stärkere Kraft!
Jacquelyn Wagner stammt aus den USA, studierte in New York und Michigan und begann ihre Karriere als Ensemblemitglied an der Deutschen Oper Berlin. Zu den Höhepunkten der jüngeren Vergangenheit zählen Leonore («Fidelio») an der Mailänder Scala und der Semperoper Dresden, Euryanthe am Theater an der Wien, Eva («Meistersinger») bei den Salzburger Osterfestspielen, Marschallin («Rosenkavalier») sowie Desdemona («Otello») in Düsseldorf und Donna Anna («Don Giovanni») an der Opéra de Paris. Am Opernhaus Zürich gibt sie als Agathe ihr Debüt.
Foto von Simon Pauly.
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 71, September 2019.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Wie machen Sie das, Herr Bogatu?
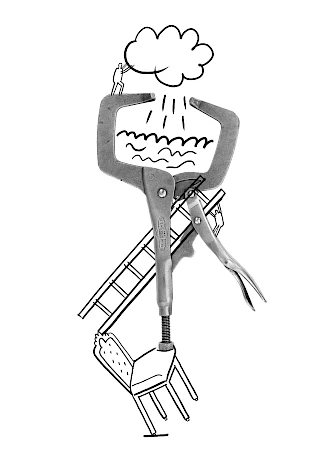
Ganz schön schief
Ein Blick hinter die Kulissen und in die Welt der Bühnentechnik von «Der Freischütz». Der technische Direktor am Opernhaus Zürich, Sebastian Bogatu, gibt Auskunft über ein vielfältiges Bühnenbild, komplizierte Dreiecksflächen und über KollegInnen, die fast wahnsinnig geworden wären.
So einfach. So kompliziert. So leicht. So schwer. So spektakulär. So stellt sich das auf der Drehscheibe stehende Freischütz-Bühnenbild von Herbert Fritsch aus technischer Sicht dar.
So einfach, weil es nur aus drei Elementen besteht: Ein gelbes Haus mit einem roten Dach, ein gelber Turm mit einer roten Turmspitze und ein grüner Boden.
So kompliziert, weil der Turm und das Haus aus grossen dreieckigen Flächen bestehen, die in allen möglichen Winkeln nahtlos aneinanderstossen und deren Teilungen man natürlich möglichst nicht sehen sollte. Die Komplexität einer solchen Konstruktion aus Stahl und Holz ist so hoch, dass unsere erfahrene technische Produktionsleiterin Marina Nordsiek beim Konstruieren am Bildschirm fast wahnsinnig geworden wäre: Kein Winkel gleicht dem anderen, keine Fläche liegt parallel zu einer anderen. Das bedeutet auch für die Herstellung in unseren Werkstätten, dass jedes einzelne Stahlprofil und jede Latte unterschiedliche Längen und Winkel haben und von Hand millimetergenau eingepasst werden mussten. Jede kleine Abweichung bei der Konstruktion hätte dazu geführt, dass keine Fläche mehr an die andere gepasst hätte und grosse Spalten entstanden wären. Wenn man jetzt noch bedenkt, dass hunderte dieser Profile in der Konstruktion verbaut wurden, wird einem die Leistung von Marina und den Werkstätten bewusst. Die Komplexität wurde dadurch noch verstärkt, dass Herbert gerne Darsteller auf das Hausdach und den Turm stellen möchte und deshalb alles sehr stabil sein muss.
So leicht, weil Haus, Turm und Dach wie Marionetten an Seilen hängen und fliegen können sollen, und so schwer, weil sie bei aller optischen Leichtigkeit doch aus einer grossen Menge an Stahl und Holz bestehen.
So spektakulär, weil alles extrem glänzen soll: So hochglänzend, dass wir das in einer auf Hochglanz spezialisierten Werkstatt lackieren lassen mussten. Das Ergebnis sind in satten Farben spiegelnde Wand- und Bodenflächen.
Spektakulär aber auch, weil sich Herbert (während ich diesen Text schreibe) auf den Probebühnen auf den fliegenden Elementen Handlungen ausdenkt, die mir wohl noch die eine oder andere schlaflose Nacht bereiten werden...
Text von Sebastian Bogatu.
Illustration von Anita Allemann.
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 41, September 2016.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Auf dem Pult

Dieses traurige kleine Motiv im Fagott erklingt ganz zum Schluss von Webers Oper. Es ist der Moment der Wahrheit. Um beim Probeschuss um die Hand Agathes nicht zu versagen, ging Max, der Titelheld, einen unheilvollen Pakt mit dem Teufel ein und liess sich in der Wolfsschlucht Freikugeln giessen. Als Agathe beim Schuss niedersinkt («Schiess nicht! Ich bin die Taube»), sich dann aber zum Glück wieder erholt, verlangt Fürst Ottokar bei Max nach einer Erklärung. Dieses Fagott-Motiv nun leitet Max’ Geständnis ein, dass er mit Samiel, dem Teufel, paktierte. Dreimal erklingt das Motiv. Zunächst zu den Worten «Herr, unwert bin ich Eurer Gnaden», dann zu «Ich kann nicht wagen, mich zu beklagen» und schliesslich bei «Zu schwach war ich». Ottokar will Max gänzlich aus der Dorfgemeinschaft ausstossen, doch dann erscheint der Eremit. Überzeugt vom Unsinn des Brauches des Probeschusses bittet er für Max um Vergebung und erreicht, dass Max ein Probejahr erhält. Ich persönlich verbinde mit dieser Stelle ebenfalls einen Moment der Wahrheit: Der Freischütz war die erste wichtige Oper in meinem eigenen Probejahr und bewirkte wohl, dass ich schliesslich ins Orchester aufgenommen wurde. An dieser Stelle begriff ich, dass man dieses Solo mit grossem Ton und viel Zeit spielen sollte. Weber schreibt dolce darunter. Das bedeutete in der damaligen Zeit vor allem espressivo und ist daher mit besonderem Ausdruck zu spielen. Es war natürlich besonders schön, dass damals Nikolaus Harnoncourt am Pult stand, der mir dafür auch den nötigen Raum gab.
—Urs Dengler
Der Freischütz
Synopsis
Der Freischütz
ERSTER AUFZUG
Der Jäger Max wird von anhaltendem Schusspech verfolgt. Obwohl er zu den besten Schützen des Dorfes gehört, trifft er nichts mehr. Er steht unter grossem Druck, denn er will Agathe, die Tochter des Erbförsters Kuno, heiraten. Bedingung für diese Hochzeit ist ein öffentlich abgelegter Probeschuss. So will es ein alter Brauch: Nur wem der Probeschuss gelingt, darf die Försterstochter heiraten und die Försterei erben.
Auch beim grossen Sternschiessen hat Max versagt. Der Bauer Kilian hat ihn besiegt und ist der neue Schützenkönig. Das Volk feiert den Sieger und verspottet den Verlierer Max.
Der Erbförster Kuno setzt der immer aggressiver werdenden Verhöhnung ein Ende. Auf Bitten Kilians erzählt er noch einmal, wie es zur Tradition des Probeschusses kam: In alten Zeiten pflegte man Wilderer zur Strafe auf einen Hirschen zu binden. Ein Vorfahre Kunos im Försteramt wurde Zeuge einer solchen Szene, bekam Mitleid und versprach dem Schützen, der den Hirsch erlegt, ohne den Wilderer zu verletzen, das Erbe der Försterei. Der Schuss gelang, aber es ging das Gerücht um, der Schütze hätte eine teuflische Freikugel geladen. Deshalb beschloss man, dass jeder Anwärter auf die Försterei zuerst einen Probeschuss ablegen muss.
Max verzweifelt an seiner verloren gegangenen Treffsicherheit und dem drohenden Verlust seiner geliebten Agathe.
Der sinistre Jäger Kaspar nimmt Max zur Seite und redet ihm ein, sein Gewehr sei verhext. Er verleitet ihn zum Trinken und erklärt ihm, nur mit einer Freikugel werde er beim Probeschuss erfolgreich sein. Er könne Freikugeln beschaffen, man müsse sie nur gemeinsam um Mitternacht in der Wolfsschlucht giessen. Mit einer von Kaspars Kugeln erlegt Max einen in unerreichbarer Höhe fliegenden Adler. Das überzeugt diesen. Max willigt ein, um Mitternacht in die Wolfsschlucht zu kommen.
Kaspar, der einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hat, triumphiert: Vom Netz der Hölle sei Max umgarnt, nichts mehr könne ihn vor dem Fall retten.
ZWEITER AUFZUG
Agathe wartet am Vorabend ihrer Hochzeit im Forsthaus sehnlichst auf Max. Ein Bild des Urahnen Kuno ist von der Wand gefallen. Ännchen, eine junge Verwandte Agathes, versucht die bekümmerte Braut aufzuheitern, die sich um Max und das gemeinsame Liebesglück sorgt. Endlich erscheint Max. Doch er will gleich wieder fort. Er behauptet, einen kapitalen Hirsch geschossen zu haben, der noch in der Wolfsschlucht liege. Den müsse er nach Hause schaffen. Die bangen Frauen können ihn vom Gang an den verrufenen Ort nicht abbringen.
Kaspar wartet in der furchterregenden Wolfsschlucht auf Max. Er ruft den schwarzen Jäger Samiel. Der erscheint. Kaspars Pakt mit Samiel sieht vor, dass er ihm alle drei Jahre ein neues Opfer zuführen muss, sonst ist seine eigene Seele des Teufels. Am folgenden Tag läuft Kaspars Frist ab. Samiel gestattet den Guss von sieben Freikugeln für Max und Kaspar: «Sechse treffen, sieben äffen.» Das heisst: Sechs Kugeln treffen nach dem Willen des Schützen, aber die siebente lenkt Samiel nach seinem eigenen Willen.
Max trifft in der Wolfsschlucht ein. Ihn schaudert. Er sieht den Geist seiner toten Mutter, und in einer weiteren Spukvision, wie Agathe stürzt. Kaspar vollzieht das Ritual des Freikugelgiessens. Jeder Guss wird von gespenstischen Erscheinungen begleitet. Der Höllenspuk steigert sich von Kugel zu Kugel.
DRITTER AUFZUG
Am Morgen der Hochzeit und des Probeschusses hat Max den Fürsten Ottokar und seine Jagdgesellschaft mit treffsicheren Schüssen beeindruckt. Vier Freikugeln hat er von Kaspar bekommen, drei hat er verschossen. Die vierte hebt er sich für den Probeschuss auf. Kaspar verschiesst seine drei Kugeln sinnlos, aufdass für den Probeschuss nur noch die siebente und letzte übrig bleibt.
Agathe ist in angstvoller Stimmung. Sie deutet die Albträume der vergangenen Nacht als schlechte Vorzeichen. Sie sah sich als weisse Taube, auf die Max zielte. Sie sucht Trost in ihrem Vertrauen auf Gott. Ännchen versucht sie erneut aufzumuntern mit einer scherzhaften Gruselgeschichte.
Die Brautjungfern singen Agathe ein Lied und Ännchen bringt den Jungfernkranz. Aber in der Schachtel befindet sich eine Totenkrone. Agathe beschliesst, sich einen neuen Jungfernkranz winden zu lassen aus den weissen Rosen, die ihr ein frommer Eremit bei einem Besuch zum Schutz gegen Unheil geschenkt hat.
Der Augenblick des Probeschusses ist gekommen. Der Fürst zeigt auf eine weisse Taube als Ziel. Max schiesst. Agathe bricht zusammen. Aber sie ist nur ohnmächtig geworden. Die Kugel hat sie nicht getroffen, durch die weissen Rosen des Eremiten war sie geschützt. Stattdessen ist Kaspar tödlich getroffen.
Max gesteht, mit Freikugeln geschossen zu haben. Fürst Ottokar verbietet ihm die Hochzeit mit Agathe und verbannt ihn aus der Dorfgemeinschaft. Wundersam erscheint der fromme Eremit und ergreift Partei für Max. Er empfiehlt, die Verbannung von Max in ein Probejahr umzuwandeln und den unmenschlichen Brauch des Probeschusses abzuschaffen.






















