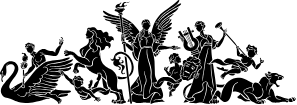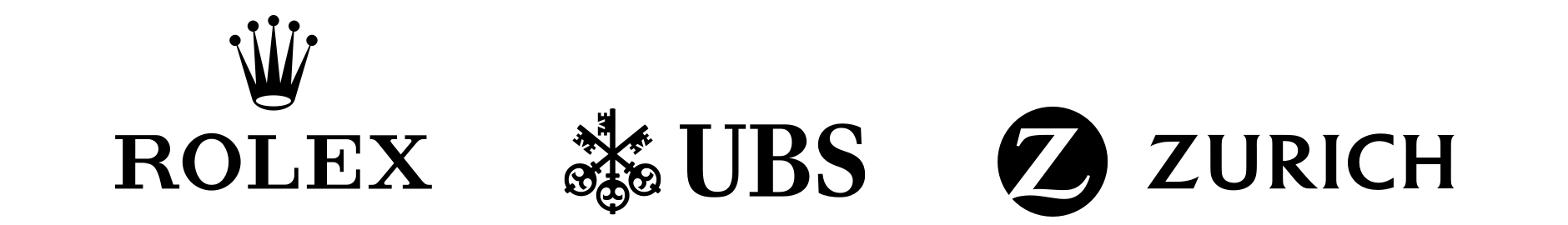Gianandrea Noseda ist seit der Spielzeit 2021/22 Generalmusikdirektor des Opernhauses Zürich. Zudem ist er Musikdirektor des National Symphony Orchestra und Erster Gastdirigent des London Symphony Orchestra. 2019 wurde er Musikdirektor des neu gegründeten Tsinandali Festivals und des georgischen Pan-Caucasian Youth Orchestra. 2007 bis 2018 amtierte Noseda als Generalmusikdirektor des Teatro Regio di Torino und hat das Opernhaus während dieser Zeit künstlerisch neu ausgerichtet. Noseda hat die wichtigsten internationalen Orchester (Berliner Philharmoniker, Chicago Symphony, Concertgebouw Orchestra, Wiener Philharmoniker) sowie an den bedeutendsten Opernhäusern (La Scala, Metropolitan Opera, Royal Opera House) und Festivals (BBC Proms, Edinburgh, Salzburg und Verbier) dirigiert. Er hat leitende Funktionen u. a. beim BBC Philharmonic (Chefdirigent), Israel Philharmonic Orchestra (Erster Gastdirigent), Mariinsky Theater (Erster Gastdirigent) und beim Stresa Festival (Künstlerischer Leiter) innegehabt. Seine Diskografie umfasst mehr als 80 CDs – einen besonderen Platz nimmt das Projekt «Musica Italiana» mit vernachlässigtem italienischem Repertoire des 20. Jahrhunderts ein. Der in Mailand geborene Noseda ist Commendatore al Merito della Repubblica Italiana und erhielt 2024 den Verdienstorden der Stadt Mailand. 2015 wurde er als «Musical America’s Conductor of the Year» geehrt, bei den International Opera Awards 2016 zum «Dirigenten des Jahres» ernannt und erhielt 2023 den Puccini-Preis. Im selben Jahr zeichneten die Oper!Awards Noseda als «Besten Dirigenten» aus, wobei insbesondere seine Interpretationen der ersten beiden «Ring»-Opern am Opernhaus Zürich hervorgehoben wurden.
Il trovatore
Dramma lirico in vier Teilen von Giuseppe Verdi (1813-1901)
Libretto von Salvatore Cammarano, fertiggestellt von Leone Emanuele Bardare,
nach «El trovador» von Antonio García Gutiérrez
Von 24. Oktober 2021 bis 26. November 2021
-
Dauer:
2 Std. 45 Min. Inkl. Pause nach ca. 1 Std. 15 Min. -
Sprache:
In italienischer Sprache mit deutscher und englischer Übertitelung. -
Weitere Informationen:
Werkeinführung jeweils 45 Min. vor Vorstellungsbeginn.


Gianandrea Noseda


Adele Thomas
Adele Thomas stammt aus Wales. Sie ist ist Opern- und Theaterregisseurin und übernimmt 2025 gemeinsam mit Sarah Crabtree als Joint General Director und CEO die Leitung der Welsh National Opera. Adele Thomas studierte an der Cambridge University Regie, war Stipendiatin des renommierten RTYDS Programms für Regisseur:innen und ist Absolventin des National Theatre Studio Kurses für junge Regisseur:innen. Ihr Debüt als Opernregisseurin gab sie mit Così fan tutte an der Northern Ireland Opera in Belfast. Daraufhin inszenierte sie für das Royal Opera House London Händels Berenice am Linbury Theatre; diese Inszenierung wurde für einen Olivier Award als beste Opernproduktion nominiert. Zuletzt inszenierte sie u. a. Vivaldis Bajazet am Royal Opera House London und der Irish National Opera (ebenfalls mit einem Olivier Award als beste Opernproduktion nominiert), In the Realms of Sorrow für das London Handel Festival, Semele beim Glyndebourne Festival sowie Rigoletto an der Welsh National Opera. Am Opernhaus Zürich inszenierte sie 2021 Verdis Il trovatore (Koproduktion mit dem Royal Opera House London). Als Schauspielregisseurin inszenierte sie u. a. Oresteia am Shakespeare’s Globe Theatre in London, Thomas Tallis und The Knight of the Burning Pestle am Sam Wanamaker Playhouse des Globes, Macbeth für die Bristol Tobacco Factory und The Weir für das English Touring Theatre.


Annemarie Woods
Annemarie Woods gewann 2011 gemeinsam mit dem Regisseur Sam Brown den Ring Award in Graz sowie den European Opera Prize. In gemeinsamen Produktionen mit Sam Brown stattete sie u. a. I Capuleti e i Montecchi am Teatro Sociale di Como, Der Zigeunerbaron am Stadttheater Klagenfurt, Sigurd der Drachentöter an der Bayerischen Staatsoper in München, Il trionfo del Tempo e del Disinganno am Badischen Staatstheater Karlsruhe, die Uraufführung von Gerald Barrys Oper The Importance of Being Earnest an der Opéra National de Lorraine in Nancy sowie La Cenerentola am Luzerner Theater aus. Eine langjährige Zusammenarbeit verbindet sie ausserdem mit dem Regisseur Oliver Mears, dessen Inszenierungen von Macbeth, Salome, L’elisir d’amore und Don Giovanni sie ebenfalls ausstattete. Weitere Arbeiten waren Candide in Nancy, Agrippina in Limerick, My Fair Lady in Karlsruhe und L’Heure espagnole / Gianni Schicchi (Regie: Bruno Ravella) an der Opéra National de Lorraine. Mit Ted Huffman arbeitete sie u. a. in Frankfurt für Rinaldo, in Köln für Salome, in Montpellier für Le Songe d’une nuit d’été, an der Deutschen Oper Berlin für A Midsummer Night’s Dream sowie in Zürich für Madama Butterfly zusammen. Zudem entwarf sie die Kostüme für Pagliacci / Cavalleria rusticana in Amsterdam (Regie: Robert Carsen), für La traviata an der Komischen Oper Berlin (Regie: Nicola Raab) und für Osud beim Janáček Brno Festival (Regie: Robert Carsen). Am Opernhaus Zürich gestaltete sie die Kostüme für Adele Thomas’ Inszenierung von Il trovatore, Ted Huffmans Inszenierungen von Girl with a Pearl Earring und Roméo et Juliette sowie für Evgeny Titovs Inszenierung von L’Orfeo.


Franck Evin
Franck Evin, geboren in Nantes, ging mit 19 Jahren nach Paris, um Klavier zu studieren. Nachts begleitete er Sänger im Café Théâtre Le Connetable und begann sich auch für Beleuchtung zu interessieren. Schliesslich entschied er sich für die Kombination aus Musik und Technik. Dank eines Stipendiums des französischen Kulturministeriums wurde er 1983 Assistent des Beleuchtungschefs an der Opéra de Lyon. Hier arbeitete er u. a. mit Ken Russel und Robert Wilson zusammen. Am Düsseldorfer Schauspielhaus begann er 1986 als selbstständiger Lichtdesigner zu arbeiten und legte 1993 die Beleuchtungsmeisterprüfung ab. Besonders eng war in dieser Zeit die Zusammenarbeit mit Werner Schröter und mit dem Dirigenten Eberhard Kloke. Es folgten Produktionen u. a. in Nantes, Strassburg, Paris, Lyon, Wien, Bonn, Brüssel und Los Angeles. Von 1995 bis 2012 war er Künstlerischer Leiter der Beleuchtungsabteilung der Komischen Oper Berlin und dort verantwortlich für alle Neuproduktionen. Hier wurden besonders Andreas Homoki, Barrie Kosky, Calixto Bieito und Hans Neuenfels wichtige Partner für ihn. Im März 2006 wurde Franck Evin mit dem «OPUS» in der Kategorie Lichtdesign ausgezeichnet. Seit Sommer 2012 arbeitet er als künstlerischer Leiter der Beleuchtungsabteilung an der Oper Zürich. Franck Evin wirkt neben seiner Tätigkeit in Zürich weiterhin als Gast in internationalen Produktionen mit, etwa an den Opernhäusern von Oslo, Stockholm, Tokio, Amsterdam, München, Graz sowie der Opéra Bastille, der Mailänder Scala, dem Teatro La Fenice, der Vlaamse Opera und bei den Bayreuther Festspielen.


Janko Kastelic
Janko Kastelic ist ein kanadisch-slowenischer Dirigent, Chorleiter, Pianist und Organist. Er begann seine musikalische Ausbildung in Kanada am Royal/Western Conservatory of Music und der St. Michael’s Choir School. Er hat einen Abschluss in Dirigieren, Komposition und Musiktheorie von der Universität Toronto und setzte sein Studium an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Wien fort. Seit 2017 ist er Chordirektor am Opernhaus Zürich. Er war einer der Kapellmeister der Wiener Hofmusikkapelle, Studienleiter des JET-Programms für junge Sänger am Theater an der Wien und Assistent bei den Bayreuther Festspielen sowie Gastchordirektor an der Hamburgischen Staatsoper. Zu den Positionen, die er im Lauf seiner Karriere bekleidet hat, gehört auch die Stelle des Generalmusikdirektors und Operndirektors am Slowenischen Nationaltheater Maribor, des Zweiten Chordirektors an der Wiener Staatsoper sowie des Korrepetitors an der Opéra National de Paris. Er war Assistenzprofessor an der Universität Ljubljana und Mentor an der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien. Seine künstlerischen Leistungen sind dokumentiert auf mehreren Live-Aufnahmen, darunter Tschaikowskis Pique Dame und Schönbergs Moses und Aron. Er arrangierte und dirigierte auch Werke für die Feierlichkeiten zum Mozartjahr 2006. Zu seinen Arbeiten beim Klangbogen-Festival in Wien gehört die europäische Erstaufführung von Blochs Macbeth. Janko Kastelic ist auch ein engagierter Pädagoge, der sich der Förderung der nächsten Generation von Musikerinnen und Musikern verschrieben hat.


Emma Woods
Emma Woods ist eine britische Choreografin und Movement Director. Künstlerisch ist sie vor allem im Raum London und an der Südküste des Vereinigten Königreichs tätig. Sie arbeitet u. a. mit Adele Thomas, Paul Foster, Bartlett Sher, Alistair David, Laurence Cummings, Sir Antonio Pappano, Rachel Kavanagh, Chris Gattelli, John Wilson, Christian Curnyn, Sarah Travis, Anthony Van Laast und Steve Ridley zusammen. In jüngster Zeit war sie u. a. tätig als Choreografin für Rigoletto an der Welsh National Opera (Welsh Millenium Centre und UK-Tour), als Movement Director für Junkyard (Backstage Theatre, Peckham) und A Comedy Of Errors (Silk Street), als Choreografin für Blond Eckbert/Acis und Galatea (Potsdamer Winteroper), Semele (Glyndebourne Opera House) und Il trovatore (Royal Opera House, Covent Garden und Opernhaus Zürich), als Choreografin und Associate Director für In The Realms of Sorrow (London Handel Festival, StoneNest), als Movement Director für Vinegar Tom (Mack Theatre), als Associate Director für Bajazet (Irish National Opera and Royal Opera House), als Choreographin für Fascinating Aïda (UK-Tour); als Movement Director für Apollo e Daphne, 4/4 (Royal Opera House), als Movement und Associate Director für Così fan tutte (Nevill Holt Opera und NI Opera, Belfast), als Associate Choreographer von The King and I (London Palladium, UK-Tour und Theatre Orb, Japan) sowie als Movement Director für Berenice (Royal Opera House) und Eyam (Shakespeare’s Globe Theatre, London).


Jonathan Holby
Jonathan Holby ist Kampfsportler und Kampfchoreograf. Er begann im Alter von 7 Jahren mit dem Karate-Training und unterrichtete bereits als Jugendlicher an der Seite seines Vaters eigene Klassen. Jonathan ist in verschiedensten Kampfkünsten und an vielen Waffen ausgebildet. Er ist als Kampfchoreograf und -koordinator sowohl für die Bühne als auch für den Film tätig und arbeitet in London und international. Mit der Kampfchoreografie kam er erstmals während seiner Ausbildung als Schauspieler in Berührung; seither arbeitet er eng mit Regisseur:innen und Schauspieler:innen zusammen. Als Kampfchoreograf war er u.a. für folgende Inszenierungen tätig: Romeo and Juliet; Hamlet; Twelfth Night; The Tempest; Macbeth; A Midsummer Night’s Dream (Shakespeare’s Rose Theatre), Cabaret (Playhouse Theatre); The King and I (London Palladium); The Lion, The Witch and the Wardrobe (UK Tour). Filme, an denen er als Kampfchoreograf mitgewirkt hat, waren u.a.: Tuesday; Tiny Dancer; Swing for the Fences; Amaranthine; Lily; Damned; Protecters of the Dawn; My Mother; Work; Crossed; Hal; Billy, Held; Becks and the Ex.


Beate Breidenbach
Beate Breidenbach studierte zuerst Violine, dann Musikwissenschaft und Slawistik in Nowosibirsk, Berlin und St. Petersburg. Nach Assistenzen an der Staatsoper Stuttgart und der Staatsoper Unter den Linden Berlin wurde sie als Musikdramaturgin ans Theater St. Gallen engagiert, drei Jahre später wechselte sie als Dramaturgin für Oper und Tanz ans Theater Basel. Anschliessend ging sie als Operndramaturgin ans Opernhaus Zürich, wo sie bisher mit Regisseurinnen und Regisseuren wie Calixto Bieito, Dmitri Tcherniakov, Andreas Homoki, Herbert Fritsch, Nadja Loschky, Kirill Serebrennikov und anderen arbeitete und die Entstehung neuer Opern von Pierangelo Valtinoni, Michael Pelzel, Samuel Penderbayne und Jonathan Dove betreute. Gastdramaturgien führten sie u.a. an die Potsdamer Winteroper (Le nozze di Figaro, Regie: Andreas Dresen), zum Schweizer Fernsehen (La bohème im Hochhaus) und 2021 an die Opéra de Génève (Krieg und Frieden, Regie: Calixto Bieito). Mit Beginn der Spielzeit 2026/27 wird sie als Chefdramaturgin an die Deutsche Oper Berlin wechseln.
Besetzung
Un vecchio zingaro Jeremy Bowes
Un vecchio zingaro Piotr Lempa 28 Okt / 06, 12, 20 Nov
Tanzensemble Manuel von Arx 24, 28 Okt / 02, 06, 09, 12, 17, 20, 26 Nov
Tanzensemble Martin Durrmann 24, 28 Okt / 02, 06, 09, 12, 17, 20, 26 Nov
Tanzensemble Tomasz Robak 24, 28 Okt / 02, 06, 09, 12, 17, 20, 26 Nov


Quinn Kelsey
Quinn Kelsey stammt aus Hawaii. 2005 vertrat er die USA bei der «BBC Singer of the World Competition» in Cardiff und ist inzwischen ein gefragter Gast an Häusern wie der Metropolitan Opera, der San Francisco Opera, der L yric Opera of Chicago, dem Royal Opera House, Covent Garden und dem Opernhaus Zürich vor allem für das Verdi-, Puccini- und französische Repertoire. 2015 wurde er mit dem Beverly Sills Award der Metropolitan Opera ausgezeichnet. Er sang u.a. Conte di Luna in Verdis Il trovatore in San Francisco und in Dresden, in Das schlaue Füchslein in Florenz, als Sharpless in Madama Butterfly an der New York City Opera, als Amonasro in Aida bei den Bregenzer Festspielen, als Ezio in Verdis Attila in San Francisco sowie als Paolo in Simon Boccanegra in Rom. In der Titelrolle von Verdis Rigoletto war Quinn Kelsey in Zürich, London (ENO), Frankfurt, San Francisco, an der Opéra National de Paris und an der Wiener Staatsoper zu erleben und als Giorgio Germont (La traviata) gastierte er in Seoul, Chicago, San Francisco, am ROH London sowie in Zürich. Er war u.a. als Peter (Hänsel und Gretel), Enrico (Lucia di Lammermoor), Giorgio Germont und als Rigoletto an der Met, mit seinem Rollendebüt als Posa (Don Carlo) an der Washington National Opera, als Miller (Luisa Miller) in Chicago, als Duke of Nottingham (Roberto Devereux) an der Los Angeles Opera, als Scarpia (Tosca) beim 2021 Summer Festival in Cincinnati und als Conte di Luna (Il trovatore) am Opernhaus Zürich zu erleben. Jüngst debütierte er u.a. als Simon Boccanegra an der Opera Philadelphia und sang Graf Anckarström (Un ballo in maschera) an der Met.


Marina Rebeka
Marina Rebeka begann ihre musikalische Ausbildung in ihrer Heimatstadt Riga und schloss ihr Studium am Conservatorio Santa Cecilia in Rom ab. 2007 gewann sie den Wettbewerb «Neue Stimmen» in Gütersloh. Seit ihrem internationalen Durchbruch – 2009 bei den Salzburger Festspielen unter Riccardo Muti – ist sie regelmässig an den führenden Opernhäusern und Festivals zu Gast, u. a. an der Mailänder Scala, der Metropolitan Opera und Carnegie Hall New York, dem Royal Opera House Covent Garden London, dem Concertgebouw Amsterdam, der Bayerischen Staatsoper, der Wiener Staatsoper, dem Opernhaus Zürich oder der Lyric Opera Chicago. Sie arbeitet mit Dirigenten wie Zubin Mehta, Antonio Pappano, Valery Gergiev, Fabio Luisi, Yannick Nézet-Séguin und Daniele Gatti zusammen. Ihr Repertoire reicht vom Barock über Belcanto und Verdi bis hin zu Tschaikowsky und Britten. Auf ihrem eigenen Plattenlabel Prima Classic hat sie das Album Spirito (Szenen und Arien des dramatischen Belcanto), Verdis Oper La traviata und ihre Soloalben Elle (französische Opernarien) und Credo (eine Auswahl geistlicher und spiritueller Lieder) veröffentlicht. In jüngster Zeit sang sie u. a. Aida an der Staatsoper Berlin, Norma am Teatro Massimo di Palermo, Mimì (La bohème), Cherubinis Medea sowie Elena (I vespri siciliani) an der Mailänder Scala, Leonora (Il trovatore) an der Bayerischen Staatsoper München, Violetta Valéry (La traviata) am Teatro di San Carlo in Neapel, Lida (La battaglia di Legnano) beim Verdi Festival Parma sowie Elena (I vespri siciliani) beim Festival d’Aix-en-Provence und zuletzt Cio-Cio-San (Madama Butterfly) an der Wiener Staatsoper.


Agnieszka Rehlis
Agnieszka Rehlis stammt aus Polen. Sie studierte Gesang an der Karol-Lipiński-Musikakademie in Breslau. Von 1996 bis 2007 gehörte sie zum Ensemble der Oper Breslau und sang dort u. a. Fenena (Nabucco), Maddalena (Rigoletto), Siébel (Faust), Cherubino (Le nozze di Figaro) und Dorabella (Così fan tutte). 2003 debütierte sie am Teatr Wielki in Warschau als Fenena, später verkörperte sie dort auch Azucena (Il trovatore), den Komponisten in Ariadne auf Naxos, Orsini (Lucrezia Borgia), Adalgisa (Norma) und Lisa in Die Passagierin von Weinberg. 2014 übernahm die Sängerin bei der Neuproduktion von Die Passagierin bei den Bregenzer Festspielen die Partie der Hannah, eine Rolle, die sie in Folge auch am Lincoln Center New York, in Houston und Chicago interpretierte. Besondere Aufmerksamkeit widmet Agnieszka Rehlis dem Schaffen Krzysztof Pendereckis, unter dessen Leitung sie in vielen seiner Kompositionen mitwirkte, so etwa im Te Deum, Credo, Polnischen Requiem sowie in seiner Siebten und Achten Sinfonie. In jüngster Zeit sang sie Amneris (Aida) u. a. in London, Warschau, Dresden, Neapel, Frankfurt und in der Arena di Verona, Brangäne (Tristan und Isolde) in Sevilla und La Cieca (La Gioconda) bei den Opernfestspielen Salzburg. Am Opernhaus Zürich war sie u. a. als Azucena (Il trovatore) und in Verdis Messa da Requiem zu erleben. In der Spielzeit 2024/25 wird sie u. a. Azucena am Royal Opera House London und an der Staatsoper Berlin sowie Amneris in Florenz und Verona singen. In Florenz singt sie 2025 in Verdis Requiem unter Leitung von Zubin Mehta.


Piotr Beczała
Piotr Beczała zählt zu den gefragtesten Tenören unserer Zeit. Seit seinem Debüt an der Met als Duca (Rigoletto) 2006, sang er dort ausserdem Lenski (Jewgeni Onegin), den Prinzen (Rusalka), Edgardo, Rodolfo, Vaudémont (Iolanta), Riccardo, Gounods Roméo, Faust, Maurizio (Adriana Lecouvreur) und Werther sowie Des Grieux (Manon). Seine Interpretation des Duca brachte ihm 2014 den Echo Klassik als Sänger des Jahres ein. An der Scala in Mailand sang er Duca, Rodolfo und Alfredo (La traviata). Bei den Salzburger Festspielen, wo er 1997 als Tamino debütierte, feierte er als Roméo, Prinz, Rodolfo und als Faust sowie in konzertanten Aufführungen von Iolanta und Werther Erfolge. Auch als Konzert- und Liedsänger ist er weltweit gefragt. Piotr Beczała, der aus Polen stammt und seit 2012 Schweizer ist, studierte an der Musikakademie in Katowice. Er war langjähriges Ensemblemitglied am Opernhaus Zürich. Neben einer Reihe von DVDs u. a. aus dem Opernhaus Zürich umfasst seine Diskografie Soloalben wie Mein ganzes Herz, The French Collection, Salut, Verdi und Slavic. Bei den International Opera Awards 2018 wurde er zum Sänger des Jahres ausgezeichnet. 2016 debütierte er mit Lohengrin an der Seite von Anna Netrebko an der Semperoper Dresden und sang die Rolle erneut 2017 in Zürich, im Sommer 2018 bei den Bayreuther Festspielen sowie 2020 an der Wiener Staatsoper. Im Sommer 2022 gab er sein Debüt als Radamès in Aida bei den Salzburger Festspielen. In Zürich war er zuletzt als Prinz Sou-Chong in Das Land des Lächelns, als Werther, als Chevalier des Grieux in Manon, mit einem Liederabend, bei einer Operettengala und als Calàf in Turandot zu erleben.


Robert Pomakov
Robert Pomakov stammt aus Kanada und studierte am Curtis Institute of Music Gesang. Er ist Preisträger mehrerer internationaler Wettbewerbe, u.a. des Königin Elisabeth Wettbewerbs in Belgien, des Belvedere Gesangswettbewerbs Wien und von Placido Domingos Operalia. Ausserdem wurde er mit dem «Simeon», der Ersten Ehrenmedaille des bulgarischen Kulturministeriums, mit einem Diplom des Kulturministers sowie mit einem Förderpreis im Wettbewerb der George-London-Stiftung ausgezeichnet. Sein Debüt gab er an der Metropolitan Opera in New York als Monterone in Rigoletto und kehrte seither als Mathieu (Andrea Chénier), Bartolo (Le nozze di Figaro), Gastwirt (Manon), Mönch (Don Carlo) und als Bonze (Madama Butterfly) zurück. Mit der Canadian Opera Company sang er Alberich in Götterdämmerung, Bartolo, Hobson in Peter Grimes und den Kammerherrn in Le Rossignol. Ausserdem gastierte er an der Houston Grand Opera als Monterone, Benoît (La bohème) und Haly (L’italiana in Algeri), an der Oper Frankfurt als Gremin (Eugen Onegin) und am La Monnaie in Brüssel als Varlaam (Boris Godunow). Auf dem Konzertpodium sang er u.a. die Basspartie in Beethovens Missa Solemnis mit dem Calgary Philharmonic Orchestra, König Heinrich (Lohengrin) mit dem Victoria Symphony Orchestra, die Basspartie in Verdis Requiem mit dem New Mexico Philharmonic Orchestra, Beethovens 9. Sinfonie mit dem Sioux City Symphony Orchestra und Mozarts Requiem beim Elora Festival in Ontario. Am Opernhaus Zürich war er bereits als Fernando in Il trovatore zu erleben.


Bożena Bujnicka
Bożena Bujnicka stammt aus Polen und studierte an der Fryderyk-Chopin-Musikuniversität in Warschau. Sie war Mitglied des Young Artists Program des Teatr Wielki in Warschau sowie Erasmusstudentin an der Guildhall School of Music and Drama in London. Sie hat zahlreiche Preise bei nationalen und internationalen Wettbewerben gewonnen, darunter den 1. Preis beim Nationalen Gesangswettbewerb Złote Głosy in Warschau. 2015 gab sie ihr Operndebüt als Amore in Glucks Orfeo ed Euridice am Teatr Wielki, wo sie seither u.a. als Gräfin Ceprano in Rigoletto und als First Girl in Der feurige Engel zu erleben war. An der Oper in Breslau gastierte sie jüngst als Donna Elvira (Don Giovanni), als Micaëla (Carmen) und als Yemaya (Yemaya, Queen of Seas) sowie an der Kammeroper Warschau als Contessa di Almaviva (Le nozze di Figaro). Neben ihren Auftritten als Sängerin arbeitet Bożena Bujnicka auch als Regisseurin. So gab sie 2017 ihr Regiedebüt mit der Inszenierung von About the Kingdom of Day and Night and Magic Instruments, einer Kurzversion der Zauberflöte am Teatr Wielki und inszenierte zuletzt Händels Aci, Galatea e Polifemo für das Festival Dramma per Musica in Polen. Seit der Spielzeit 2021/22 ist sie Mitglied im Internationalen Opernstudios Zürich und war hier in L’incoronazione di Poppea, Il trovatore, Simon Boccanegra, Le Comte Ory, Macbeth, Rigoletto und Jakob Lenz zu erleben.


Omer Kobiljak
Der Tenor Omer Kobiljak stammt aus Bosnien und wurde in der Schweiz geboren. Er studierte Gesang bei David Thorner, zuerst am Konservatorium Winterthur, dann an der Kalaidos Fachhochschule Aarau. Er besuchte Meisterkurse bei Jane Thorner-Mengedoht, David Thorner und Jens Fuhr und erhielt 2012 beim Thurgauer Musikwettbewerb den Ersten Preis mit Auszeichnung. Im Jahr darauf sang er bei den Salzburger Festspielen einen Lehrbuben («Die Meistersinger von Nürnberg») unter Daniele Gatti und debütierte mit derselben Rolle 2017 an der Mailänder Scala. Ab der Spielzeit 2017/18 war er Mitglied des Internationalen Opernstudios am Opernhaus Zürich und hier u. a. in «La fanciulla del West», «Parsifal», «Der fliegende Holländer» und «La traviata» zu erleben. Er sang ausserdem Lord Arturo Buklaw («Lucia di Lammermoor») sowie den Notaren in der konzertanten Aufführung von «La sonnambula». Seit 2019/20 gehört Omer Kobiljak dem Ensemble des Opernhaus Zürich an und sang hier seither u. a. Abdallo («Nabucco»), Macduff («Macbeth»), Froh («Das Rheingold»), Alfredo («La traviata»), Tybalt («Roméo et Juliette»), den Verrückten Hutmacher («Alice im Wunderland») und Ein Sänger («Der Rosenkavalier»). Weitere Engagements umfassen den Fürsten Alexis (Umberto Giordanos «Siberia»), Yamadori («Madama Butterfly») und Don Riccardo («Ernani») bei den Bregenzer Festspielen und die Titelrolle in «Der Graf von Luxemburg» bei den Tiroler Festspielen Erl. 2023 war Omer Kobiljak Finalist der Operalia Competition in Kapstadt. Jüngst gab er seine Hausdebüts als Lord Arturo Buklaw an der Semperoper Dresden, als Froh an der Opéra de Monte-Carlo und als Narraboth («Salome») beim Baltic Opera Festival in Polen.


Andrei Skliarenko
Andrei Skliarenko wurde in Russland geboren, wo er am Tschaikowsky Music College in Jekaterinburg und am Jekaterinburg State Mussorgsky Konservatorium studierte. Nach seinem Abschluss war er Mitglied des Young Artist Program am Bolschoi-Theater. Sein Debüt auf der Bühne des Bolschoi-Theaters gab er 2017 in der OperDer steinerne Gast von Alexander Dargomyschski. Er trat in zahlreichen Kammerkonzerten in der Beethoven Halle des Bolschoi-Theaters auf. 2018 war er in Rossinis Stabat Mater am Teatro Comunale di Cagli zu hören, 2019 nahm er beim Winter International Arts Festival in Sochi teil. Im selben Jahr sang er Don Ottavio (Don Giovanni) in der Suzhou Jinji Lake Concert Hall in China. Er gewann 2014 den 2. Preis der Tolyatti International Music Competition, 2016 bekam er das Diplom «Beste Gesangsleistung» der militärischen Streitkräfte der Russischen Föderation und war 2017 Preisträger des Wettbewerbs der Gesangsabsolventen Russlands. Seit 2020/21 ist er Mitglied des Internationalen Opernstudios am Opernhaus Zürich und war hier in Boris Godunow, Les Contes d’Hoffmann, in L’incoronazione di Poppea sowie zuletzt in Il trovatore zu sehen. 2022 gastierte er ausserdem am Theater Bielefeld als Belmonte in Die Entführung aus dem Serail.


Andrei Skliarenko
Andrei Skliarenko wurde in Russland geboren, wo er am Tschaikowsky Music College in Jekaterinburg und am Jekaterinburg State Mussorgsky Konservatorium studierte. Nach seinem Abschluss war er Mitglied des Young Artist Program am Bolschoi-Theater. Sein Debüt auf der Bühne des Bolschoi-Theaters gab er 2017 in der OperDer steinerne Gast von Alexander Dargomyschski. Er trat in zahlreichen Kammerkonzerten in der Beethoven Halle des Bolschoi-Theaters auf. 2018 war er in Rossinis Stabat Mater am Teatro Comunale di Cagli zu hören, 2019 nahm er beim Winter International Arts Festival in Sochi teil. Im selben Jahr sang er Don Ottavio (Don Giovanni) in der Suzhou Jinji Lake Concert Hall in China. Er gewann 2014 den 2. Preis der Tolyatti International Music Competition, 2016 bekam er das Diplom «Beste Gesangsleistung» der militärischen Streitkräfte der Russischen Föderation und war 2017 Preisträger des Wettbewerbs der Gesangsabsolventen Russlands. Seit 2020/21 ist er Mitglied des Internationalen Opernstudios am Opernhaus Zürich und war hier in Boris Godunow, Les Contes d’Hoffmann, in L’incoronazione di Poppea sowie zuletzt in Il trovatore zu sehen. 2022 gastierte er ausserdem am Theater Bielefeld als Belmonte in Die Entführung aus dem Serail.


Francesco Guglielmino
Francesco Guglielmino wurde in Solothurn geboren. Mit 21 Jahren zog er nach Zürich, wo er sich seiner Tanzausbildung widmete und in den Musicals Fame und Hair auftrat. Von Zürich ging er nach New York, vertiefte dort seine Schauspieltätigkeit und nahm an der Alvin Ailey American Theater School und am Broadway Dance Center Tanzunterricht. Er arbeitete zudem als Model für Modenschauen und für die Werbung. An der Acting Studio and Stella Adler Acting School besuchte er Schauspielklassen und war als Schauspieler in verschiedenen Produktionen der Metropolitan Opera zu sehen, wie etwa in Turandot, Madama Butterfly, La bohème und Aida. Nach seinem Umzug nach Los Angeles war er in zahlreichen Fernsehproduktionen und TV-Shows zu erleben, u.a. in CSI: Miami, CSI: New York, Law and Order, The View und The Ellen Show. Zudem spielte er diverse Rollen in Filmen und Serien wie The Pink Panter, Sex and the City, Edgar, Death in Love und Till Death. Seit 2018 lebt Francesco Guglielmino wieder in Solothurn. Am Opernhaus Zürich war er in Così fan tutte, Il trovatore, Dialogues des Carmélites und Roberto Devereux zu sehen.


Steven Forster
Steven Forster wuchs in Zürich auf und liess sich an der Zürich Tanz-Theater-Schule ausbilden. Er ist Mitglied der Lit Dance Company sowie der Focus Crew. Als freischaffender Tänzer tanzte er unter anderem in mehreren Produktionen am Opernhaus Zürich, bei den Salzburger Festspielen, in diversen Operetten in der Schweiz sowie im Rahmen von Shows und Aufträgen von Unternehmen wie Lindt & Sprüngli, IWC, Bucherer, SRF, Freitag, Samsung, VZug, Salt, Stadler Rail, Coop, Cartier, Ricola sowie im Kunsthaus Zürich während der «Langen Nacht der Museen». 2019 war er im Ensemble von Jesus Christ Superstar im Le Théâtre und daraufhin Tänzer im Showensemble der MS Artania von Phoenix Reisen. In der Spielzeit 2022/23 war er in der Tanzkompagnie des Theaters St. Gallen unter der Leitung von Kinsun Chan engagiert und war nebenbei Gasttänzer im Stück Z.trone in der DOXS Tanzkompanie.
Pressestimmen
Pressestimmen
«[…] was für ein Wunder diese Aufführung geschafft hat: Sie hat dieses Werk nicht gebändigt, sondern zeigt seine Wucht, seine Widersprüche, seinen ganzen emotionalen Wahnsinn»
Tagesanzeiger, 25.10.2021
«Das Herz und der Kopf aber, der das Geschehen ebenso befeuert wie im Zaum hält, ist Noseda.»
NZZ, 25.10.2021
«Musikalisch ein Fest auf erstklassigem Niveau»
Deutschlandfunk, 25.10.2021
«Kein Zweifel, da kommt einer nach Zürich, der gross denkt und etwas zeigen will.»
Kulturtipp, Nr.23/21
«Um ein Haar hätte man mitgesungen»
FAZ, 27.10.21
Gut zu wissen

Kreaturen, die aus der Hölle kommen
( Interview )
Die britische Regisseurin Adele Thomas inszeniert «Il trovatore», der am 24. Oktober 2021 Premiere hatte. Im Interview spricht sie über die Tiefgründigkeit der Figuren, warum zu Tragödien immer auch Komik gehört und was Verdis Oper mit den Schreckensbildern des Hieronymus Bosch zu tun hat.
Ein Begriff voller Widersprüche
( Hintergrund )
In Giuseppe Verdis Oper «Il trovatore» spielt die «Zigeunerin» Azucena eine zentrale Rolle. Meint der Begriff der «Zigeunerin» nur eine romantische Opernkonvention, oder ist er diffamierend? Ein Gespräch aus dem Jahr 2021 mit der Schweizer Schriftstellerin Isabella Huser, die ein Buch mit dem Titel «Zigeuner» geschrieben hat.

Der Chor ist wieder da
( Drei Fragen an Andreas Homoki )
«Die Kraft, die von einer grossen Gruppe singender Menschen ausgeht, ist in den darstellenden Künsten mit nichts zu vergleichen, und wenn die Regie es schafft, diese Energie in Bewegungen, Situationen und Bilder umzusetzen, ist die Wirkung kolossal.»
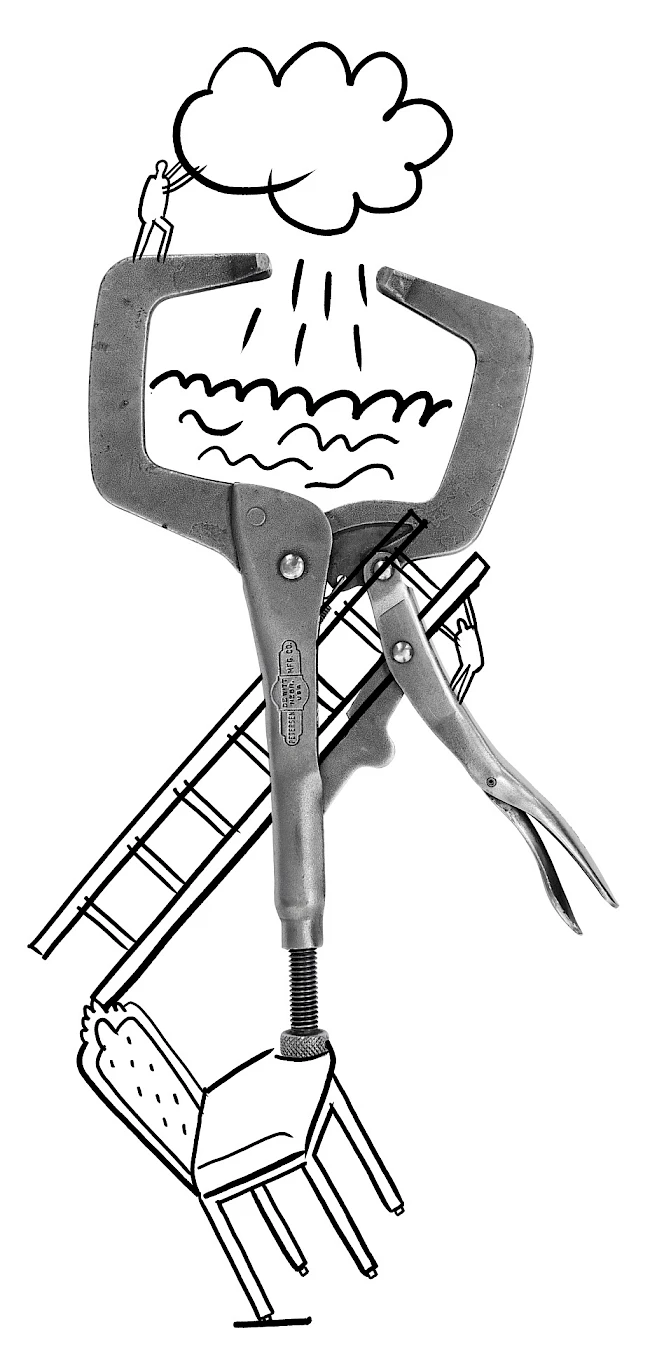
Von unten nach oben
( Wie machen Sie das, Herr Bogatu? )
Wenn Sie einmal eine Technische Direktorin oder einen Technischen Direktor ärgern möchten, dann denken Sie sich ein Bühnenbild aus, bei dem einfach alles von unten nach oben fährt. Ich bin mir sicher, dass sich unsere Regisseurin Adele Thomas und ihre Bühnenbildnerin Annemarie Woods das Bühnenbild zu Trovatore nicht ausgedacht haben, um mich zu ärgern – aber hier kommt sehr viel von unten: Personen, die aus dem Boden herausklettern, Zähne, Vorhänge und eine Treppe. Ja, Sie haben richtig gelesen, riesige Zähne. Aber wo liegt das Problem?

Marina Rebeka
( Volker Hagedorn traf 2021... )
Marina Rebeka stammt aus Riga. Seit ihrem internationalen Durchbruch 2009 bei den Salzburger Festspielen unter Riccardo Muti ist die Sopranistin regelmässig an den führenden Opernhäusern zu Gast. In jüngster Zeit sang sie Amelia («Simon Boccanegra») bei den Salzburger Festspielen und in Wien, Violetta in Mailand, Desdemona in Florenz und Leonora in Verdis «Il trovatore» am Opernhaus Zürich.

Jetzt trage ich Verantwortung
Gespräch
Gianandrea Noseda, dies ist Ihre erste Spielzeit als neuer Generalmusikdirektor am Opernhaus Zürich. Wie geht es Ihnen, wenn Sie dieses Haus betreten – wie empfinden Sie die Atmosphäre?
Seit ich vor vier Jahren zum allerersten Mal hier war, um Verdis Macbeth zu dirigieren, habe ich mich immer wohlgefühlt. Das Opernhaus Zürich ist sehr produktiv, das professionelle Niveau ist sehr hoch. Und die Menschen, die hier arbeiten, sind sehr nett. Mehr kann man sich nicht wünschen! Jetzt bin ich allerdings nicht mehr nur Gast, sondern Generalmusikdirektor, also trage ich auch Verantwortung, vor allem für die musikalische Qualität, nicht nur in meinen eigenen Produktionen. Aber ich bin umgeben von grossartigen Kolleginnen und Kollegen, deshalb bin ich sehr zuversichtlich.
Einer der Gründe, warum Sie sich entschieden haben, nach Zürich zu kommen, war die Möglichkeit, hier den Ring des Nibelungen zu dirigieren. Diese vier Opern gehören wahrscheinlich zu den am meisten interpretierten Stücken des gesamten Repertoires. Warum ist es für einen Dirigenten interessant, noch eine weitere Interpretation zu liefern?
Für mich persönlich ist es interessant, weil ich nicht aus einem deutschsprachigen Land komme und der Ring für mich lange Zeit unerreichbar schien – wie etwas, das ich wahrscheinlich nie machen würde. Aber es ist ein Unterschied, ob ich als Italiener in Deutschland dirigiere – oder in der Schweiz! Hier in der Deutschschweiz fühle ich mich wohler damit. In einem deutschen Opernhaus hätte ich mich das vielleicht nicht getraut. Ich dachte: Wer sonst wird mir einen Ring anbieten? Es ist einfach eine schöne Herausforderung.
Mit dem Trovatore – der ersten Premiere, die Sie als Generalmusikdirektor bei uns dirigieren – sind Sie dagegen in Ihrem ureigensten Terrain unterwegs, in der italienischen Oper…
Ja, das Stück habe ich in Salzburg, an der Metropolitan Opera in New York und am Royal Opera House in London dirigiert, ich kenne es also ziemlich gut.
Wann immer man sich mit diesem Stück beschäftigt, liest man, wie schrecklich und vollkommen unverständlich die Geschichte sei – und wie fantastisch die Musik. Aber Verdi hat diesen Stoff ja sehr bewusst gewählt; was denken Sie, was hat ihn an dieser düsteren und tatsächlich ja etwas verwirrenden Geschichte fasziniert?
Dass sie so voll von Konflikten ist, aber auch voller Mysterien, voller Rätsel! Im Trovatore ist es nicht so einfach zu entscheiden, wer hier eigentlich gut ist und wer böse; in anderen Opern von Verdi ist das viel klarer. Der Conte di Luna mag uns auf den ersten Blick als der «Böse» und Manrico, sein Widersacher, als der «Gute» erscheinen. Aber dann erfahren wir – ganz am Schluss des Stückes –, dass die beiden Brüder sind. Diese Erkenntnis stellt alles auf den Kopf. Die Oper hat durchgängig eine unglaublich hohe Temperatur. Es geht um Feuer, Dunkelheit, Blut. Alles beginnt mit einem Scheiterhaufen, auf dem eine Frau verbrennt, und mit dem Mord an einem kleinen Jungen. Das Libretto ist – wenn man die sprachliche Ebene anschaut – durchaus raffiniert gemacht. Aber es geht bis an die Grenzen dessen, was uns akzeptabel und glaubwürdig erscheint – und manchmal auch darüber hinaus. Gleichzeitig gibt es eben auch Passagen, die zum Besten gehören, was Verdi je komponiert hat. Man hat den Eindruck, Verdi hatte endlos Kohle zur Verfügung, um das Feuer nicht nur weiter zu schüren, sondern immer noch heftiger lodern zu lassen. Manchmal kann man die Intensität der Musik und der Situationen fast nicht aushalten.
Die Tatsache, dass Azucena den Sohn des Grafen ins Feuer werfen wollte, dann aber aus Versehen ihr eigenes Kind verbrannte, ist allerdings schon nicht so ganz leicht nachzuvollziehen…
Es sei denn, man bedenkt, dass sie fast von Sinnen war vor Schmerz darüber, dass ihre Mutter als Hexe verbrannt wurde! Der Schmerz über dieses grausame Unrecht begleitet sie bis zu ihrem Tod im letzten Bild, wenn sie schliesslich selbst auf dem Scheiterhaufen sterben muss.
Was man ebenfalls oft liest über dieses Stück: Im Trovatore habe Verdi einen Schritt zurück gemacht in seiner kompositorischen Entwicklung und sich wieder mehr der Belcanto-Oper zugewandt. Können Sie das nachvollziehen?
Für mich ist es kein Schritt zurück. Es mag verwirren, dass es Momente gibt, die an Belcanto erinnern, wie die zweite Arie der Leonora oder die Arie des Grafen, die auch zu einer späten Donizetti-Oper gehören könnten.
Die musikalische Charakterisierung von Azucena hat mit Belcanto allerdings gar nichts zu tun…
Nein, schöne Melodien, die es im Trovatore natürlich auch gibt und zwar in grosser Zahl, sucht man bei Azucena vergebens. Das beginnt übrigens schon mit dem Text, denken wir an ihre erste Arie, «Stride la vampa». Wie könnte man einen solchen Text in eine Belcanto Melodie fassen? Überhaupt ist Azucena in Verdis Figurenarsenal etwas ganz Neues: Sie ist die erste Hauptfigur, die von einem Mezzosopran verkörpert wird; Ulrica im Maskenball, Eboli in Don Carlo und Amneris in Aida werden später folgen.
Azucena war so wichtig für Verdi, dass er sogar die Oper ursprünglich nach ihr benennen wollte.
Schon in der ersten Szene, in der Erzählung Ferrandos, geht es um sie. Ihre Musik zieht sich durch die Oper, und noch ganz am Schluss spielt die Flöte ein Zitat aus ihrer ersten Arie. Ihre Besessenheit von Rache ist es, die das Stück vorantreibt.
Wie ist Manrico musikalisch charakterisiert?
Manrico ist eine fragmentierte Persönlichkeit. Er ist ein Künstler, er spielt Laute und singt, und zugleich ist er ein Krieger. Er kämpft auf der Seite des Revolutionärs Urgel. Ausserdem ist er «Zigeuner», aber eigentlich – wie wir als Zuschauer, aber auch er selbst erst ganz am Schluss erfahren – ist er der Bruder eines Grafen. Zu Beginn hört man ihn aus dem Off, zusammen mit der Harfe, wie er das Liebeslied eines Troubadours für Leonora singt. Das revolutionäre Element hören wir dann in seiner Cabaletta, aber auch in der Art und Weise, wie er mit seinem Vertrauten Ruiz spricht. Manrico ist getrieben von seinen Leidenschaften; das wiederum drückt sich zum Beispiel in seiner berühmten Arie «Di quella pira» aus. Im Gegensatz zum Grafen, der sehr viel kontrollierter agiert, lässt Manrico sich immer wieder von seinen Gefühlen mitreissen. Deshalb kann er auch am Schluss, als Leonora ihm sagt, er solle fliehen, nur an eins denken: Dass sie ihn und seine Liebe verraten hat. Anstatt sein Leben zu retten, ist er mit seiner Eifersucht beschäftigt. Er kennt nur schwarz oder weiss, entweder – oder. Als Azucena ihm erzählt, dass sie damals das falsche Kind ins Feuer geworfen hat und er gar nicht ihr Sohn ist, weigert er sich einfach, das zu glauben. Sie ist seine Mutter – basta!
Die Szene, die mich musikalisch am meisten beeindruckt, ist der Beginn des vierten Teils, wenn Leonora in den Turm geht, in dem Manrico gefangen gehalten wird, um ihn zu retten. Wie schafft es Verdi, diese unglaublich spannungsvolle Atmosphäre zu erzeugen?
Das ist eine Filmszene! Wir sehen eine Figur im Zoom – Leonora. Eine andere, Manrico, sehen wir aus der Ferne, wie aus einer anderen Welt; er singt hinter der Bühne. Dazwischen haben wir die Flashbacks im Kopf von Azucena. Dann gibt es Ruiz, der das Grauen beschreibt, das er sieht: den Scheiterhaufen, das Beil des Henkers. Dazu kommt ein religiöses Element: der Chor, der im Hintergrund ein Miserere singt, im Rhythmus eines Trauermarschs. All diese Elemente sind wie verschiedene Schichten, die ineinander geschnitten werden, und ergeben ein sehr komplexes Bild.
Was ist Ihnen bei Ihrer musikalischen Interpretation besonders wichtig?
Ich versuche, all das, was in der Partitur steht, ernst zu nehmen, keinen Akzent zu vermeiden, weil er «zu viel» sein könnte, sondern im Gegenteil jeden Akzent explodieren zu lassen. Das Pianissimo so zu gestalten, dass es wirklich unheimlich wird und einem Schauer über den Rücken jagt. Im Miserere, von dem wir gerade sprachen, gibt es eine Glocke, die man in vielen Aufführungen gar nicht hört. Ich denke, sie muss furchterregend sein, so ähnlich wie die Glocken in Boris Godunow – das ist die Glocke des Todes! Der einzige Weg für mich, dieses Stück zu dirigieren, ist, spirituell und emotional vollkommen nackt zu sein, alles zu geben und keinerlei Angst zu haben vor moralischer Verurteilung. In Trovatore geht es um Extreme. Das müssen wir rüberbringen.
Eine Woche nach der Premiere dirigieren Sie ein Philharmonisches Konzert. Der Solist ist der fantastische russische Pianist Daniil Trifonov. Haben Sie schon öfter mit ihm gearbeitet?
Wir haben mehrere Konzerte gegeben, das letzte war erst kürzlich in Washington. Da hat er das erste Klavierkonzert von Schostakowitsch gespielt, davor sind wir mit dem zweiten Klavierkonzert von Prokofjew am Verbier Festival aufgetreten und in Wien mit dem zweiten Konzert von Rachmaninow. Ich bin sehr neugierig zu sehen, wie er das Brahms Konzert angeht – und wie die Kombination eines deutschen Werks mit einem italienischen Dirigenten, einem russischen Pianisten und einem Schweizer Orchester aus Musikerinnen und Musikern aus vielen verschiedenen Nationen funktioniert! Bei Brahms denkt man immer an einen seriösen deutschen Komponisten, aber es gibt einige sehr kindliche und zärtliche Elemente in seinen Werken, die man selten wahrnimmt. Er war ein Mensch, der sich sehr um seine Freunde sorgte und ständig mit ihnen in Kontakt stand. Er hatte übrigens auch eine sehr kindliche Stimme, die man auf der einzigen Aufnahme hören kann, die es von ihm gibt; diese Stimme entspricht so gar nicht dem Bild des älteren bärtigen Mannes, das wir kennen! Wir finden in Brahms’ Werken das grandiose, majestätische Element, aber auch die Liebe zum Detail, verbunden mit einer grossen Zärtlichkeit. Um all das hörbar zu machen, braucht man einen Solisten wie Daniil Trifonov, der sehr abenteuerlustig ist, sehr tief empfindet, aber auch in der Lage ist, die gegensätzlichsten Elemente miteinander zu verbinden.
Sie lieben das deutsche Repertoire, aber auch das slawische Repertoire liegt Ihnen am Herzen.
Ja, deshalb habe ich für die zweite Hälfte des Philharmonischen Konzerts die achte Sinfonie von Antonín Dvořák programmiert. Brahms liebte Dvořák sehr und hat ihn oft beraten. Die Struktur der achten Sinfonie von Dvořák ist Brahms und überhaupt der deutschen Sinfonik sehr nah – mit slawischen Elementen natürlich, vor allem in der Melodik. Also eine gute Kombination, wie ich finde.
Das Gespräch führte Beate Breidenbach.
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 86, Oktober 2021.
Das MAG können Sie hier abonnieren.

Kreaturen, die aus der Hölle kommen
Interview
Adele, dies ist deine erste Operninszenierung hier am Opernhaus Zürich. Wie war dein Weg bisher, welche Erfahrungen haben dich geprägt?
Die ersten zehn Jahre meiner Karriere habe ich im Schauspiel gearbeitet, aber das war nicht unbedingt das, wovon ich geträumt hatte. Als ich mit Anfang 20 zum ersten Mal Alban Bergs Wozzeck auf der Bühne sah, hat das alle meine Sinne geöffnet. Ich verstand, dass Oper das war, was ich immer machen wollte. Im Grunde habe ich aus allen meinen Schauspielinszenierungen Opern gemacht. Ich hatte immer Live-Musik dabei, manchmal DJs, oft auch einen Chor oder ein Alte-Musik-Ensemble.
Trotzdem hat es lange gedauert, bis man dir eine Oper angeboten hat. Warum?
In Grossbritannien gelte ich nicht als klassische Opernregisseurin. Vor allem, weil ich eine junge Frau bin. Dazu kommt, dass sich der Weg über Regieassistenzen für mich nicht richtig angefühlt hat. Ich bin eine schreckliche Assistentin! Und so dachte ich lange, dass ich niemals in der Oper arbeiten würde. Ich habe die Orestie von Aischylos am Globe Theatre inszeniert, als wäre es eine Oper, wenn ich schon nicht an einem Opernhaus arbeiten durfte… Daraufhin bekam ich dann die Chance, am Opernhaus in Belfast Così fan tutte zu inszenieren. Es folgte Georg Friedrich Händels Berenice am Royal Opera House; diese Inszenierung wurde für einen Laurence Olivier Award nominiert, und seitdem bekomme ich nur noch Angebote für Operninszenierungen.
Wie würdest du deine Theatersprache beschreiben?
Die Komödie ist für mich sehr wichtig. Ich bin überzeugt davon, dass die Natur des Menschen im Grunde komisch ist. Auch wenn Geschichten extrem tragisch sind…
… wie das im Trovatore zweifellos der Fall ist.
Es gibt in jeder tragischen Geschichte immer auch komische Elemente. Meine Theatersprache ist ausserdem sehr physisch, oft auch stilisiert. Ich arbeite eng mit der Choreografin Emma Woods zusammen. Aber es muss immer alles in den Emotionen verankert sein. Das Schönste ist für mich, wenn die Zuschauer hinterher sagen: Das ging aber schnell vorbei! Dann habe ich meinen Job gut gemacht. Ich denke immer an die Zuschauer, wenn ich inszeniere. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass ich nicht mit der Oper aufgewachsen bin, dass ich sie nicht einfach als selbstverständlich ansehe. Ich arbeite dafür, dass ich die Menschen erreiche und dass das, was sie sehen, in ihren Herzen ankommt.
Diese Inszenierung ist deine erste Begegnung mit Verdi. Was fasziniert dich an diesem Opernkomponisten?
Verdi ist ein fantastischer Dramatiker. Alles, was er möchte, und wovon er auch in seinen Briefen immer wieder schreibt, ist wirkungsvolles Musiktheater. Die Art und Weise, wie er durch die Musik die Geschichte erzählt, ist absolut faszinierend. Wenn man sich mit dem Trovatore beschäftigt, erfährt man natürlich erstmal, dass die Geschichte absolut unverständlich und lächerlich ist…
Denkst du das auch?
Nein, das denke ich nicht! Wir haben die Geschichte im 15. Jahrhundert angesiedelt, in einer fantastischgrotesken Welt, wie sie uns in den Bildern von Hieronymus Bosch begegnet. Der Plot des Trovatore passt gut in diese Welt, in der die Imagination der Menschen zuweilen eine wichtigere Rolle spielt als die Realität. Die Beziehungen zwischen den Figuren, die Situationen, denen sie ausgesetzt sind, ihre Emotionen – all das ist grossartig. Indem wir es nicht realistisch erzählen, wird es glaubwürdiger und – hoffentlich – auch verständlicher. Hier sind ganz eindeutig magische, übernatürliche Kräfte am Werk. Es gibt viel Aberglauben in diesem Stück und sehr tief sitzende Erinnerungen. Für mich könnten diese Figuren keine heutigen Menschen sein, sie gehören eindeutig in die Zeit des 15. Jahrhunderts. Klar, Verdis Musik ist die Musik des 19. Jahrhunderts. Aber wenn man das Drama liest, das der Oper zugrunde liegt, dann spürt man darin die Welt eines Robin Hood oder eines Henry V.
Es sind vor allem die wirkungsvollen Situationen und die extremen emotionalen Zustände der Figuren, die für Verdi im Zentrum stehen und an der sich seine Musik entzündet.
Absolut. Und meine Inszenierungsarbeit geht ganz stark von der Musik aus. Im Grunde ist Verdi sehr leicht zu inszenieren: Man weiss genau, in welchem Takt, in welcher Note jemandem das Herz bricht… Man kann sich vollkommen auf die Musik verlassen. In der britischen Theatertradition kommt die Interpretation immer aus dem Text – oder eben aus der Musik; es ist alles schon da, man muss nur tief genug graben. Diese archäologische Arbeit macht mir grossen Spass.
Wenn du es auf einen Punkt bringen müsstest: Worum geht es für dich im Trovatore?
Das Thema, das den grossen Bogen über das Stück spannt, ist Azucenas «mi vendica», ihr Schrei nach Rache. Es ist, als ob ein Fluch entfesselt wurde von jemandem, der diese Worte murmelt. Im weiteren Verlauf geht es um eine geradezu ekstatische Verbindung der Figuren zur Welt und zum Universum. Ekstase und Obsession treiben den Plot voran.
Auch das Geschichten-Erzählen spielt in der Handlung eine wichtige Rolle, vieles hängt davon ab, auf welche Weise eine Geschichte erzählt wird.
Es ist grossartig, dass das Stück Der Troubadour heisst, denn damit ist ja ein Geschichtenerzähler gemeint. Im Grunde hat jede Figur ihren Troubadour-Moment – einen Moment also, in dem sie oder er eine Geschichte aus ihrer Perspektive erzählt. Zu Beginn erzählt Ferrando einer Gruppe von Männern seine Version der Geschichte aus der Vergangenheit, auf der die Oper beruht; später erzählt Azucena dieselbe Geschichte aus ihrer Perspektive – und ganz anders. Leonora wiederum erzählt, wie sie den Troubadour kennengelernt hat. Die Art und Weise, in der Geschichten weitergegeben werden, bestimmt das Handeln der Figuren.
Das Geschichten-Erzählen kann auch als Manipulation eingesetzt werden.
Ja, und dabei werden bewusst Dinge angesprochen, die leider nach wie vor existieren, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus zum Beispiel. So setzt man – wie Ferrando in der ersten Szene des Stückes – obsessive, gefährliche Kräfte in Gemeinschaften frei, die nicht mehr aufzuhalten sind.
Diese Fremdenfeindlichkeit richtet sich gegen Azucena, die im Stück als «Zigeunerin» bezeichnet wird.
Dass sie «Zigeunerin» genannt wird, weist darauf hin, dass es um eine Aussenseiterin, eine Randständige geht, deren Fremdheit Ängste auslöst. In der Zeit, in der das Stück spielt, gab es nachweislich in Spanien noch gar keine «Zigeuner». Ich erinnere mich an das Theaterstück Die Hexe von Edmonton aus dem frühen 17. Jahrhundert. Die Hauptfigur ist eine alte Frau, die von der Gemeinschaft als Hexe bezeichnet wird; und da nun einmal alle sie so sehen, beschliesst sie, auch eine Hexe zu werden, und geht einen Bund mit dem Teufel ein. Sie sagt den unglaublichen Satz: «Ich bin nur eine Grube, in die die Menschen ihren Dreck hineinwerfen.» Azucena ist ein bisschen wie diese Frau. Sie hat diesen Hintergrund der «Zigeuner», der Nicht-Sesshaften, und wird als gefährliche Hexe wahrgenommen. Sie ist sogar innerhalb der Gemeinschaft, der sie angehört, eine Aussenseiterin. Ihr gilt Verdis volle Sympathie – es geht ihm ja gerade darum, das Leiden dieser Aussenseiterin sichtbar zu machen.
Azucena ist die eigentliche Hauptfigur der Oper. Eine Zeit lang wollte Verdi sogar die Oper nach ihr benennen.
Für mich ist sie eine der faszinierendsten Figuren der gesamten Opernliteratur. Sie trägt ständig eine Maske und wechselt diese Masken fast mit jedem Satz, den sie sagt. Sie verbirgt immer etwas vor uns. Sie ist nicht fassbar und gleichzeitig extrem verletzlich. Viel ist darüber geschrieben worden, wie wild sie sei und wie stark, ihre Musik ist extrem spannungsvoll und explosiv. Und doch ist sie eben auch verletzlich. Wir wissen nie, woran wir sind mit ihr. Und vielleicht weiss sie das selbst auch nicht so genau; man hat jedenfalls den Eindruck, dass sie schon zu Beginn des Stückes langsam den Bezug zur Realität verliert. Sie versucht verzweifelt, die Kontrolle über ihr Leben zu behalten.
Und die Kontrolle über Manrico, der in dem Glauben aufgewachsen ist, ihr Sohn zu sein, der er aber in Wirklichkeit gar nicht ist.
Die Beziehung der beiden ist sehr komplex; sie sind voneinander abhängig und zerstören sich gleichzeitig gegenseitig. Manrico ist zwar der Troubadour, der Geschichten erzählt und singt, aber er ist auch ein Krieger, der mit den «Zigeunern» aufgewachsen ist. Mit der Liebe zu Leonora erlebt er zum ersten Mal ein Gefühl, das sich nicht auf seine Mutter bezieht. Seine Musik verändert sich ständig. Je nachdem, mit wem er gerade auf der Bühne ist, kann sie einen vollkommen anderen Charakter haben. Manrico ist nicht der aktive, selbstbewusste Held, den man vielleicht erwarten würde, sondern er ist so etwas wie ein Spiegel für die anderen Figuren, die sich in ihm erkennen. Er hat etwas sehr Unschuldiges.
Als er erfährt, dass er nicht der leibliche Sohn Azucenas ist, verliert er komplett den Boden unter den Füssen.
Im Grunde ist er von Beginn an in einem Krisenzustand, in dem er nicht wirklich weiss, wer er ist und wohin er gehört. Das verstärkt sich in dem Moment, in dem ihm Azucena erzählt, wie sie damals ihr eigenes Kind ins Feuer geworfen hat. Diese tiefe Unsicherheit, die Verletzlichkeit, die übrigens auch Graf Luna – Manricos Gegenspieler – empfindet, entspricht nicht dem traditionellen Bild von Männlichkeit.
Und wie würdest du Leonora charakterisieren?
Sie erinnert mich an Frauen, die Heilige sehen können oder religiöse Erscheinungen haben. Und sie hat selbst die rebellische Seite einer weiblichen Heiligen. Sie verhält sich nicht, wie eine Hofdame sich verhalten sollte. Sie hat etwas Wildes und damit auch eine Verbindung zum Ekstatischen, das ich sehr wichtig finde. Im 20. Jahrhundert wäre sie vielleicht ein Hippie gewesen.
Am Schluss ist sie bereit, ihr Leben für Manrico zu opfern.
Sie macht eine Entwicklung durch, wie man sie eigentlich vom Helden des Stückes erwarten würde. Wenn sie zum ersten Mal davon singt, dass sie bereit ist, für Manrico zu sterben, scheint sie wie ein Kind, das sich vorstellt, eine Heldin zu sein. Später dann wird das sehr real: Sie bringt dieses Opfer.
Ein Stück voll von Dunkelheit und Tod – wo findest du hier die komischen Elemente, von denen du vorhin sprachst?
Verdi war ein grosser Bewunderer von Shakespeare. Und diese komischen Elemente kommen ganz klar von Shakespeare, der gerade in den düstersten Momenten, den tragischen Höhepunkten den Clown auftreten lässt. Genauso wie das übrigens in vielen mittelalterlichen Stücken der Fall ist. So ist doch auch das Leben! Das Komische gehört ebenso dazu wie das Tragische.
Und es sind dann genau diese Kontraste, die scharfen Gegensätze, die die dramatische Wirkung ausmachen.
Als ich das erste Mal mit unserem Dirigenten Gianandrea Noseda gesprochen habe, sagte er zu mir: Was auch immer du vorhast mit deiner Inszenierung, akzentuiere die Kontraste in diesem Stück! Die Musik ändert sich von einem Moment zum anderen, sie kann vom schönsten Stillstand ins grösste Chaos umschlagen. Das ist in dieser Oper wirklich extrem.
Diese Premiere wird die erste Produktion sein, in der unser Chor endlich wieder in einer Neuinszenierung auf der Bühne steht. Wie ist die Arbeit mit dem Chor für dich? Ich liebe es, mit dem Chor zu arbeiten! Die Kraft, die entsteht, wenn so viele Menschen auf der Bühne singen und spielen, ist einfach unglaublich. An diesem Chor gefällt mir sehr, dass die Sängerinnen und Sänger bereit sind, wirkliche Charaktere auf die Bühne zu bringen, mit vielen wunderbaren Details. Man wird mindestens vier Augenpaare brauchen, um alles zu sehen!
Zum Chor kommen auch noch sechs Tänzer dazu…
Unser Tanzensemble wird nicht nur tanzen, sondern unterschiedlichste Charaktere darstellen und eine Dynamik in die Inszenierung bringen, die der Musik entspricht. Sie sind dämonische, nicht menschliche Kreaturen und repräsentieren die dunkle, zerstörerische Kraft, die aus der Hölle kommt – inspiriert von Gemälden von Hieronymus Bosch. Ich freue mich sehr über die Arbeit mit diesem fantastischen Ensemble!
Das Gespräch führte Beate Breidenbach.
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 86, Oktober 2021.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Ein Begriff voller Widersprüche
Hintergrund
Isabella Huser, Sie haben ein Buch geschrieben mit dem Titel «Zigeuner». In den letzten Monaten habe ich gelernt, dass man die Bezeichnung «Zigeuner» eigentlich gar nicht mehr verwenden sollte, weil sie diskriminierend ist. Warum haben Sie trotzdem diesen Titel gewählt?
Das Buch ist ein Roman und handelt von mir und meinen Leuten, von ihrer Geschichte in diesem Land seit napoleonischen Zeiten. Ich gehe der Geschichte meiner jenischen Vaterfamilie nach. Das Buch ist eine Auseinandersetzung mit dem Begriff und der Erfindung «Zigeuner». Für mich war es keine Frage, dass ich diese Fremdbezeichnung – in meinem Fall nunmehr auch Selbstbezeichnung – verwende. Manche meinen, wenn man ein Wort verbiete, sei damit auch die Problematik aus der Welt. Das ist sie nicht, es braucht die Auseinandersetzung. «Zigeuner» ist ein vielschichtiger Begriff, der historisch oft diffamierend verwendet wurde, nicht nur für Roma und nicht nur für Jenische. Er reicht viel weiter.
Wo kommt der Begriff her?
Die Forschung lässt die Frage offen. Eine viel zitierte These lautet, dass die ersten fremden reisenden Familienverbände, die in Europa angetroffen wurden, als Ägypter galten: «les Egyptiens», daher «gypsies», «Gitanos». Das ist aber nicht ganz schlüssig. Die Herkunft der Bezeichnung ist nicht geklärt. Das Interessante an dieser Geschichte: Die ersten fremden Reisenden wurden als Pilger betrachtet, Vertriebene aus Ägypten auf siebenjähriger Büsserreise. Diese Herkunftsgeschichte erzählt von einem Volk, das zur Wanderschaft verdammt ist.
Als Herkunftsort der Roma wird heute oft Indien genannt.
Stimmt, wobei es viele verschiedene Roma-Volksgruppen gibt. Die Jenischen wiederum haben von ihrer Abstammung her nichts mit den Roma zu tun.
Wo kommen die Jenischen her?
(Lacht.) Wenn man auf Jenische zu sprechen kommt, folgt stets die Frage nach dem Ort der Herkunft. Jenische leben in Süddeutschland, in der Schweiz, in Österreich, aber auch in Belgien und weiteren Regionen vor allem Westeuropas. Die hiesigen Jenischen sind schweizerischen Ursprungs wie andere Schweizerinnen und Schweizer auch. Meine Vorfahren stammen aus der Zentralschweiz, wie ich seit den Recherchen für meinen Roman weiss.
Ist denn der Begriff «Zigeuner» aus Ihrer Sicht gar nicht diskriminierend?
Doch, klar, immer dann, wenn das Wort als Fremdbezeichnung für eine Person oder eine Gruppe verwendet wird. Ich selbst nenne mich «Zigeunerin», weil ich, wie ich heute weiss, in einem sehr konkreten Sinn die Geschichte der Vorstellungswelten verkörpere, die diese Bezeichnung birgt. Ausserdem, weil ich mit einem gewissen Familiendünkel aufgewachsen bin. Mein Vater sagte stolz: «Wir sind Zigeuner!» Für mich ist das Wort weiterhin auch mit anderen Wertungen verbunden.
Wie sollen wir hier am Opernhaus also mit diesem Begriff umgehen – zum Beispiel in der Besetzungsliste, in der ja ein «Alter Zigeuner» vorkommt?
Ich würde die Bezeichnung in Anführungszeichen setzen. Damit ist die komplexe Frage, die Sie ansprechen, zwar nicht vom Tisch. Aber die Anführungszeichen sind ein Symbol für eine Bewusstmachung. Der Gebrauch des Wortes «Zigeuner» muss in der Kunst unbedingt weiterhin möglich sein. Sonst verlöre man diese Werke. Die darin gespiegelten romantisierenden und herabwürdigenden Bilder können ja nicht einfach durch andere ersetzt werden. Wodurch denn? Diese Werke machen uns vielmehr bewusst, durch welche Bilder wir geprägt sind.
Die «verführerische Zigeunerin» zum Beispiel, wie wir sie aus Bizets Carmen kennen. Welche Bilder hat man noch mit «Zigeunern» verbunden?
In der Kunst wird die «Zigeunerfigur» oft mit sinnlichen bis übersinnlichen Welten in Verbindung gebracht. «Zigeunerinnen» können wie Hexen zum Schaden anderer Magie einsetzen. «Zigeuner» sind aus der Gesellschaft Ausgestossene, üben aber auch eine grosse Faszination auf sie aus. Klaus-Michael Bogdal, der in seiner Studie Europa erfindet die Zigeuner die «Zigeunerbilder» anhand von Werken der Kunst erforscht, schreibt, dass «Zigeuner» etwas darstellen, zu dem man jederzeit selbst werden kann. Dann nämlich, wenn man von der sozialen Leiter fällt und den gesellschaftlichen Halt verliert. Man fürchtet sie und projiziert schlimmste Verbrechen auf «die Zigeuner»: Brunnen vergiften, Kinder entführen. Dies sind auch in der Kunst wiederkehrende Schreckensbilder.
In Il trovatore wurde die Mutter der Azucena, ebenfalls eine «Zigeunerin», als Hexe auf dem Scheiterhaufen verbrannt, weil sie angeblich das Kind des Grafen verhext hatte. Beiden, «Zigeunerin» und Hexe, werden magische Kräfte zugeschrieben, oft in Verbindung mit dem Teufel. Das Unfassbare, nicht Beherrschbare löst archaische Ängste aus. In der Kunst ist das Unfassbare in dieser Ausprägung oft weiblich. Hier dürften erotische Projektionen eine Rolle spielen.
Sie schildern in Ihrem Buch auch, dass «Zigeuner» in der Schweiz nicht immer gleich stark ausgegrenzt waren.
Die Geschichte der Jenischen in der Schweiz ist bislang erst bruchstückhaft erforscht. «Zigeuner» werden in der Geschichtsschreibung erst dann sichtbar, wenn sie mit der Macht zusammenstossen. Dies ist im 19. Jahrhundert, während die moderne Schweiz entsteht, wiederholt der Fall. Nach dem Ende der helvetischen Republik um 1800 und bis weit in die neue Eidgenossenschaft hinein werden viele jenische Familien aus ihren angestammten Orten vertrieben. Andere, die wie meine Ahnen als Händler reisende Berufe ausüben, haben Probleme, an Papiere zu kommen, Heimatscheine, Ehebewilligungen, Reisepässe. Für Jenische und andere sogenannte Heimatlose wurde alles restriktiver. Viele denken, «Zigeuner» reisen herum, ohne Ziel und Plan sozusagen. So ist es nicht und war es wohl nie. Reisende Jenische wie meine Händlerahnen hatten eine Handelsroute, man kannte seine Abnehmer, wusste, wo man unterkommen konnte. Im Frühling brach man auf, kam im Herbst mit neuer Ware in die Heimat zurück, wo man in der Regel auch überwinterte.
Also stimmt die Vorstellung, «Zigeuner» seien Heimatlose, die nirgendwo hin gehören, gar nicht…
Selbst die reisende Lebensweise sehe ich als Zuschreibung. Im Fall meiner jenischen Vorfahren ist bereits in den ersten Jahren des 19. Jahrhunderts dokumentiert, dass einige sich als reisende Händler verstanden, andere hingegen sich niederlassen wollten. Das wurde ihnen jedoch verwehrt. Es gibt allerdings auch Jenische, die keineswegs mit mir einverstanden sind, wenn ich sage, dass selbst die reisende Lebensweise eine Zuschreibung ist, die von einigen mithin – und dies trifft auch auf meine direkten Vorfahren zu – zu ihrem ureigenen Alltag und einem wichtigen Teil ihrer Kultur gemacht worden ist, keine Frage! Die Geschichte ist genauso komplex wie widersprüchlich.
Auch Ihre Familie war von der berüchtigten Aktion der Pro Juventute betroffen, die jenischen Familien in der Schweiz ihre Kinder zum Teil mit Gewalt weggenommen hat, um sie in Pflegefamilien oder Heimen unterzubringen.
Die Stiftung Pro Juventute hat zwischen 1926 und 1973 jenische Familien systematisch verfolgt, um ihnen die Kinder wegzunehmen. Dies mit behördlicher Unterstützung und mit der Begründung, dass sie – weil die Eltern «Vaganten» seien – vernachlässigt würden und nicht zur Schule gingen. Wenn wir an die Vorstellungen denken, «Zigeuner» würden Kinder stehlen, dann erscheinen uns diese als eine groteske Umkehrung der Realität! 1972 ist dann im Beobachter ein erster Artikel über diese programmatischen Kindswegnahmen erschienen. Es dauerte ein weiteres Jahr, bis das sogenannte Hilfswerk für die Kinder der Landstrasse aufgelöst wurde. Ich selbst war damals 14 Jahre alt. Für mich war es ein Schock zu erkennen, dass die Verfolgung und die Flucht, von der mein Vater uns Kindern erzählt hatte, wahr sein musste. Ich hatte seine Erzählung nur für eine Geschichte gehalten – nicht möglich, nicht bei uns! Bei meinen Recherchen wurde bald klar, dass vor allem jenen Familien Kinder weggenommen wurden, die gar nicht fähig waren zu reisen. Meine Grosseltern – sie wohnten damals am rechten Zürichseeufer, mein Vater war gerade eingeschult worden – sind davongekommen, weil sie Musikanten waren. Sie konnten mit ihren sechs Kindern fliehen und reisend überleben. Sie flohen ins Tessin, fanden in Lugano eine Anstellung in einem Hotel, wo sie den Hotelgästen zum Nachmittagstee aufspielten. Nach zwei Jahren sind sie in die Deutschschweiz zurückgekehrt und bald mit ihrer Familienkapelle bekannt geworden, was ihnen einen gewissen Schutz bot.
Dabei haben sie allerdings keineswegs, wie es dem Klischee entsprechen würde, schnulzige «Zigeunerweisen» gespielt, sondern Schweizer Volksmusik.
Es gibt viele Umkehrungen in dieser Geschichte! Es begann in den 1920er Jahren im Zürcher Niederdorf, dass Städter sich Sennenkutten überstreiften und Volksmusik wie von der Alp spielten. Das Bild der traditionellen Schweizer Volksmusik war geschaffen. An der Entstehung der hiesigen Volksmusik, wie wir sie heute kennen, sind viele jenische Familien wie die meine beteiligt. Für meine Grosseltern wäre es gefährlich gewesen, sich nach ihrer Flucht wieder irgendwo anzumelden und die Kinder zur Schule zu schicken. Sie mussten also Vorurteile erfüllen, um wegzukommen – auf der anderen Seite haben sie sich als Bergler verkleidet und Schweizer Volksmusik komponiert. Die Kinder sollten nicht mehr Jenisch sprechen, und mein Vater hat in bestimmten jenischen Kreisen sogar verschwiegen, dass er Kinder hat, um uns nicht zu gefährden. Trotzdem waren wir zuhause stolz darauf, «Zigeuner» zu sein. Übrigens hatte auch ich als Kind die Vorstellung, dass «Zigeuner» reisen, ohne dass ich mich darüber gewundert hätte, dass das bei uns nicht so war.
Wenn Sie nun in die Oper gehen und Il trovatore anschauen, haben Sie dann Angst, dass da lauter Klischees auf der Bühne zu sehen sind?
Nein, die Bilder sind nun mal geprägt. Ich bin jedes Mal gespannt zu sehen, was heute eine Regisseurin daraus macht.
Kann man denn aus Ihrer Sicht einen «Zigeunerchor», in dem davon gesungen wird, wie schwer die Arbeit der fahrenden «Zigeuner» ist und dass nur das hübsche «Zigeunermädchen» einen zu dieser Arbeit motivieren kann, heute noch auf die Bühne bringen? Wie würden Sie damit umgehen?
Unbedingt sollen diese Darstellungen auf die Bühne gebracht werden! Wie? Ich bin keine Regisseurin. Die Stücke sollen leben. Wenn nicht, wäre das Geschichtsverleugnung. Es bringt nichts, so zu tun, als hätte es diese Klischees und Stereotype nie gegeben. Es hat sie gegeben, es sind Vorstellungen daraus erwachsen, und mit denen müssen wir uns heute auseinandersetzen.
Isabella Huser ist eine Schweizer Schriftstellerin, Übersetzerin und Filmproduzentin. 2008 erschien ihr erstes Buch «Das Benefizium des Ettore Camelli», 2021 folgte der Roman «Zigeuner». Beide Bücher sind im Bilgerverlag erschienen.
Das Gespräch führte Beate Breidenbach.
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 86, Oktober 2021.
Das MAG können Sie hier abonnieren.

Der Chor ist wieder da
Drei Fragen an Andreas Homoki
Herr Homoki, Verdis Il trovatore ist die nächste Neuproduktion am Opernhaus Zürich. Darin erwacht der Opernchor endgültig aus seinem langen, deprimierenden Corona- Schlaf. In den vergangenen Wochen ist er bereits in zwei Wiederaufnahmen auf die Bühne zurückgekehrt, jetzt steuert er auf die erste Premiere zu. Wie geht es diesem von der Pandemie so stark betroffenen Kollektiv?
Die Stimmung ist sehr gelöst und positiv. Es ist ja auch kein Wunder, dass sich alle Kolleginnen und Kollegen freuen, wieder auf der Bühne zu stehen. Für den Chor waren die Lockdowns besonders schwer. Er hatte Spielverbot und konnte nur vom Kreuzplatz aus per Lautsprecher zugespielt werden. Ich weiss, wovon ich spreche, denn ich habe als Regisseur während der Pandemiezeit gleich zwei Opern inszeniert, in denen ich den Chor schmerzlich vermisst habe. Wenn ich als Sängerin oder als Sänger die Entscheidung treffe, in einen Opernchor zu gehen, dann tue ich das, weil ich gerne auf der Bühne stehe und Spass an der szenischen Darstellung habe, sonst gehe ich in einen Konzertchor. Gerade in unserem Opernchor spürt man in jeder Vorstellung, dass alle ausgesprochene Bühnenmenschen sind, und die konnten jetzt anderthalb Jahre lang nicht das tun, was sie am meisten lieben. Schrecklich. Jetzt sind sie endlich wieder da – mit grosser Entspanntheit übrigens, was die Covid-Situation angeht. Die allermeisten sind geimpft. Manche tragen auf der Probe noch eine Maske, um sich noch ein bisschen sicherer zu fühlen. Aber das Wichtigste ist: Die künstlerische Arbeit kann wieder ohne Einschränkungen stattfinden.
Was fehlt einem Opernhaus, wenn der Chor nicht auf der Bühne stehen kann?
Die Hälfte dessen, was grosse Oper ausmacht. Die Oper ist ja entstanden aus dem Bestreben, die antike griechische Tragödie wiederzubeleben, und schon dort ist die Polarität von Individuum und Chor angelegt. Mit dem Chor bekommen Opern erst ihre gesellschaftliche Dimension. Die Kraft, die von einer grossen Gruppe singender Menschen ausgeht, ist in den darstellenden Künsten mit nichts zu vergleichen, und wenn die Regie es schafft, diese Energie in Bewegungen, Situationen und Bilder umzusetzen, ist die Wirkung kolossal.
Wie laufen die Chorproben zu Il trovatore?
Sehr vielversprechend. Regisseurin ist ja die junge Britin Adele Thomas, die zum ersten Mal bei uns in Zürich inszeniert. Sie formt extreme Bilder mit dem Chor und schöpft dessen Spiellust voll aus. Die Gruppen stehen immer wieder ganz dicht zusammengedrängt und bilden expressive Massen. Es ist ein grosses Vergnügen, zu sehen, dass das, Gottseidank, jetzt alles wieder möglich ist und tadellos funktioniert. Ein Problem beim Trovatore besteht ja darin, dass sich bei dieser Oper viele naturalistische Klischeevorstellungen und entsprechende Erwartungshaltungen in den Köpfen verfestigt haben, gegen die man aninszenieren muss. Adele Thomas hat deshalb eine bewusst antinaturalistische Bühne gewählt, nämlich eine riesige, steil ansteigende Treppe, auf der sie den Chor und die Solistinnen und Solisten in sehr unterschiedlichen Formationen geradezu choreografisch führt. Das wird eine bildmächtige Inszenierung, und dem Chor kommt darin als wuselnde und immer wieder zusammengedrängte Masse eine grosse Bedeutung zu – immer hin neben so profilierten, erlesenen Sängerdarstellern wie Agnieszka Rehlis, Marina Rebeka, Piotr Beczała, Quinn Kelsey und unserem neuen Generalmusikdirektor Gianandrea Noseda am Dirigentenpult.
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 86, Oktober 2021.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
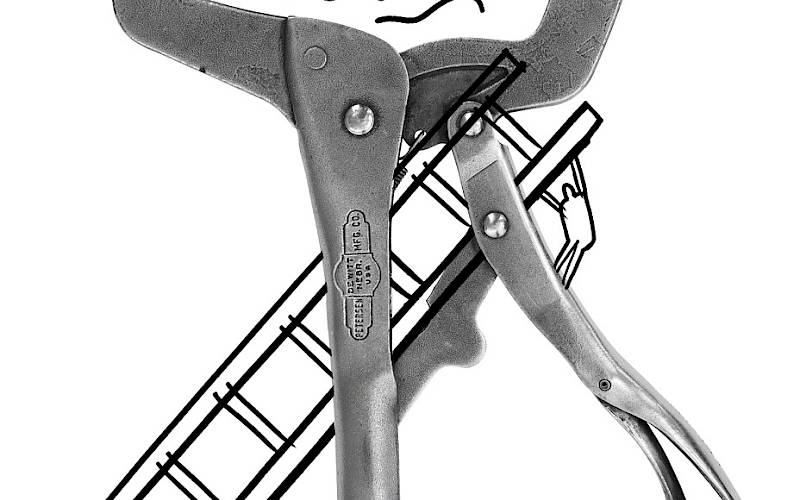
Von unten nach oben
Wie machen Sie das, Herr Bogatu?
Wenn Personen aus Klappen aus dem Boden kommen sollen, dann muss der Boden von unten zugänglich sein. Das geht nur, wenn wir unseren Bühnenboden absenken und unter das Bühnenbild ein veritables «Kellergeschoss» einbauen. Das sieht das Publikum zwar nie – dafür sieht es aber die Klappen, die in der Decke des Kellergeschosses eingebaut sind. Natürlich sind in diesem Geschoss dann auch Leitern fest eingebaut, damit man von unten durch die Klappen auftreten kann. Klingt aufwändig, ist es auch. Und dann sollen im Bühnenbild über eine Breite von 16 Metern von unten die Fangzähne eines riesigen Gebisses auftauchen. Das lösen wir, indem wir in den Boden des «Kellergeschosses» über die ganze Breite einen Schlitz machen. In diesen Schlitz steckt die Bühnentechnik beim Aufbau die Zähne und befestigt diese unten an einem stabilen Träger. Nun sind die Zähne unsichtbar unter der Bühne.
Aber wie bringt man die Zähne nun aus dem Boden nach oben? Idee: Wir hängen den Träger an Seile und ziehen den einfach hoch. Moment: Dann sieht man ja die ganze Zeit die Seile. Das ist schlecht. Deswegen lassen wir alle Seile, die das Publikum sieht, weg und befestigen nur ganz aussen je ein Seil links und ein Seil rechts, mit dem man den Träger hochziehen kann. Und schon kommen die Zähne von unten aus dem Boden. An einem fast 16 m langen Träger ist das schon eine Herausforderung.
Da wir schon bei Herausforderungen sind: Hinter den Zähnen steht über die ganze Breite des Bühnenbildes eine Treppe, die nach hinten immer höher ansteigt. Der Mittelteil dieser Treppe muss hochfahren können, während Personen darauf stehen. Einfache Übung: Da wir ja ein Kellergeschoss haben, können wir in dieses Kellergeschoss nun auch noch eine grosse Maschine einbauen, die dieses Treppenstück um einen Meter anheben kann. Dabei müssen allerdings Führungen eingebaut werden, damit das Teil nicht wackelt. Schon ist aus der einfachen Übung eine schwere Aufgabe geworden.
Getoppt wird das alles vom Feuervorhang. Ein wunderschön bemalter Vorhang, der – Sie ahnen es – von unten aus dem Boden hochfahren muss. Mein Versuch, doch wenigstens diesen ganz einfach von oben mit unseren Zügen nach unten fahren zu lassen, scheiterte, denn schliesslich lodern Flammen von unten nach oben. Wir haben also einen weiteren Schlitz in den Boden gemacht, in dem der Vorhang bereit liegt. Um den Vorhang aus dem Schlitz zu bekommen, haben wir diesen an einen weiteren stabilen Träger gehängt und diesen genau so in den Schlitz gesteckt, dass die Oberkante mit dem Boden abschliesst. Dann haben wir ihn in Bodenfarbe angemalt. So sieht das Publikum noch nicht mal den Schlitz. Auch hier sind wieder zwei Seile links und rechts ausser Sicht, an denen der Träger mit dem Vorhang von unten aus dem Boden gezogen werden kann – und das, bis das Feuer die ganze Bühnenöffnung bedeckt. So wie es sein muss: Lodernd von unten nach oben.
Sebastian Bogatu ist Technischer Direktor am Opernhaus Zürich.
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 86, Oktober 2021.
Das MAG können Sie hier abonnieren.

Marina Rebeka
Marina Rebeka
Volker Hagedorn traf 2021...
Allmählich wird es lauter um uns herum, die Opernkantine füllt sich zur Mittagszeit, soweit es eben geht, wenn aus Hygienegründen nur zwei distanzierte Plätze pro Tisch frei sind. Marina Rebeka sitzt mir in knapp zwei Metern Entfernung gegenüber; ich verstehe sie gut. Aber ihr sind ein paar Herren zu laut. Sie sieht zu ihnen hin und sagt, ohne die Stimme zu erheben, «I’m sorry, we’re making an interview here». Sofort wird es still. Das ist es wohl, was man fokussieren nennt. Kein Forte, einfach nur gut zielen. Wenn das so einfach wäre… Wenn sie singt, zielt die Sopranistin so gut, dass sie einen auch via Mikro und CD über mehrere Jahre hinweg ins Herz treffen kann. So ging es mir mit dem Crucifixus aus der Petite Messe solennelle von Gioachino Rossini, die im November 2012 in Rom mitgeschnitten wurde, Antonio Pappano dirigierte die Orchesterfassung. Fast ein Liebeslied für den Erlöser war das, gesungen mit einer Sensibilität für Ton und Text, die Oper und Kirche so verschmolz, wie es sich der Komponist erträumt haben mag. «Das Tempo darf nicht zu schnell sein», meint die Sängerin, «für eine helle Traurigkeit, a bright sadness. Das war meine erste Aufnahme überhaupt!» Ziemlich berühmt war sie da bereits, drei Jahre nach ihrem Debüt bei den Salzburger Festspielen, noch vor ihrem ersten Auftritt in Zürich.
Aber Karrieredaten sind für Marina Rebeka gar kein Thema. Eher interessiert sie sich für Manuskripte. Sie schwärmt von Rossinis Handschrift der kleinen Messe, die sie sich damals im Faksimile ansah, um festzustellen, dass es Textabweichungen gegenüber der kritischen Edition gibt, und auf ihrem Tablet zeigt sie mir das Original von Bellinis Arie «Casta diva»: Sie steht in G-Dur statt in F-Dur, einen Ganzton höher, als sie fast immer gesungen wird. «Der Kammerton war bei Bellini und Verdi nicht 443 Hertz wie heute», sagt sie, «sondern 432 Hertz. Die Streicher spielten auf Darmsaiten, alles ist weicher, nicht so aggressiv. Vielleicht kommt man mit der Hertz-Frequenz auch schneller zum Herzen!» Sie lacht. Sie kommt auch mit 443 gut klar, ohne den Differenzierungen untreu zu werden, die ihr so wichtig sind. Leonora, ihre Rolle im Zürcher Trovatore, die Frau zwischen Manrico und Graf Luna, die sich am Ende das Leben nimmt, ist für sie mehr als eine der Opferfrauen zwischen Wahnsinn und Tuberkulose, von denen es im Sopranrepertoire von Bellini bis Puccini nur so wimmelt. «Wir sehen sie immer mit dem Mond, schon beim ersten Treffen mit dem Trovatore. Auch Turandot erscheint mit dem Mond. Und Norma. Eine Gegenwelt. Die Männer sind mit der Sonne verbunden, mit Grausamkeit und Kampf.» Zugleich sei Leonora entschlossen und abenteuerlustig, «sie liebt die Nacht, die Gefahr, läuft allein herum, sie ist verliebt und leidenschaftlich, sehr lebendig!»
Arktisch helle Augen hat Marina Rebeka und ist offenkundig kein bisschen erschöpft. Nach dreistündiger Vormittagsprobe braucht sie nur einen Cappuccino zur Stärkung und sprudelt über von allem, was ihr einfällt zu dieser und anderen Rollen, zu dem, was in anderen Zeiten geschrieben wurde, in anderen gesellschaftlichen Zusammenhängen. Sie findet nicht, dass das passend gemacht werden muss. «Anstatt den Text zu ändern, musst du dein Denken ändern und dich fragen, warum das so gemacht wurde. Das Publikum ist doch nicht dumm. Wenn man weiss, dass die Umstände anders sind, in denen etwas entstand, kann man es mit unserer Zeit vergleichen und Lehren daraus ziehen.» Nur auf das Gesellschaftliche lasse sich Oper ohnehin nicht herunterbrechen, «da kommen mehr Aspekte ins Spiel. Tatjana zum Beispiel, in Eugen Onegin. Ich würde heute natürlich mit Onegin gehen und den alten Gremin sitzen lassen. Aber Tatjana war schlauer als Onegin. Sie wusste, er würde sie bald verlassen, wenn sie mitginge…» So, wie sie über diese Gestalten spricht, nimmt sie sie ganz ernst, als Menschen, nicht nur als Rollen, und wenn ihr etwas nicht einleuchtet, grübelt sie weiter, wie bei Mozarts Donna Anna, die Rolle, mit der sie in Zürich debütierte und die sie inzwischen nicht mehr singt. «Meine Stimme war passend für die zwei Extreme in ihr, das Süsse und Weiche von ‹Non mi dir› und das Messerscharfe, das schreckliche Pathos, das man für ‹Or sai› braucht. Aber immer gibt es bei ihr drei Punkte… Manipuliert sie Don Ottavio oder trauert sie wirklich um ihren Vater? Sie kann nie geradeaus sein wie Elvira. Zu sagen, dass es mir Spass macht, so eine Rolle wie Donna Anna zu singen, wäre eine Lüge. Aber es war eine Herausforderung. Ich frage mich, warum die Person so wurde. Wie wuchs sie auf? Was fehlt ihr eigentlich? Das ist überhaupt eine wichtige Frage: Was hat im Leben gefehlt?»
Im Leben von Marina Rebeka schien bis zu ihrem dreizehnten Lebensjahr nichts zu fehlen, ausser vielleicht Ballettunterricht. Im lettischen Riga wuchs sie auf, das in ihrem Geburtsjahr 1980 noch Teil der Sowjetunion war, ging zur Schule, lernte Klavier und wollte Ballerina werden. «Wir hatten ein erstaunlich gutes Ballett in Riga, ich sah alles, Giselle, Nussknacker, immer war da diese grosse Bühne mit schöner Musik.» Aber nichts war zu vergleichen mit dem Tag, als die Dreizehnjährige mit ihrem Grossvater zum ersten Mal in eine Oper ging, Norma.
Was ist da mit ihr passiert? «Was», fragt sie zurück, «passiert einer Person, die sich auf den ersten Blick verliebt? Das kann man nicht erklären. Ich wusste bis dahin nicht, was Oper ist. Ich sass da und war vollkommen getroffen. Diese Leute ohne Mikrofon, die singen und sich selbst ausdrücken durch die Stärke und die Farben ihrer Stimmen! Ich sagte, das will ich machen. Verrückt, dass die nächste Norma, die in Riga gemacht wurde, meine war. Es dauerte 24 Jahre, es brauchte Geduld, einen langen Weg und viele Abenteuer…» Der Weg führte sie über ihre Wahlheimaten Italien, Deutschland (in Erfurt hatte Marina ihr erstes Engagement), die Schweiz und Österreich schliesslich nach Riga zurück: «Der beste Ort, um mein Kind grosszuziehen». Ihre Tochter ist jetzt zehn Jahre alt. «Es ist meine Heimat. Und es ist schön, Repräsentant eines kleinen Landes zu sein!» Sie zeigt auf den Cappuccinobecher vor sich. «Wenn man da drin ist, sieht man nicht, wie gross er ist. Erst von draussen und wenn man in andere Becher geschaut hat, wird das klar, und der Reichtum darin.»
Sie knüpft mit ihrer Rückkehr auch an die Familiengeschichte an. Grossvater Juris, der als 70-Jähriger das Mädchen in die Norma führte, war der Sohn von Aleksandrs Jankovičs, hochrangiger Jurist im ersten unabhängigen Lettland bis 1940. Darum wurde Juris Jancovičs, ein Ingenieur, 1941 von Stalin mit seiner ganzen Familie nach Sibirien deportiert. «Er hat dort einen 120-köpfigen Chor geleitet», sagt Marina, «und spielte sehr gut Klavier». Mit der zweiten Unabhängigkeit 1991 wurde die Oper besonders wichtig. «Es war eine harte Zeit, es fehlten Jobs und Geld. Die Oper war darin ein goldener Traum, den man sich leisten konnte. Die Galerie war voll mit Studenten und Leuten mit wenig Geld. Die Zugänglichkeit ist für Oper der entscheidende Impuls!»
Vielleicht auch aus dieser Erfahrung heraus hat sie «keine Sekunde gezögert», als sie im Sommer 2020 gefragt wurde, ob sie als Violetta beim Wagnis von Madrid mitmachen wolle: Grosse Oper vor Publikum, Traviata, mitten in der Pandemie. «Wir waren so auf Distanz bedacht, Alfredo konnte Violetta nicht umarmen. Wir mussten so auf diese zwei Meter achten. In diesen zwei Metern liegt der Tod, dieser Gedanke liess mich das durchhalten, dazu die Botschaft für die ganze Welt: Die Kunst muss weitergehen!» Das Kostüm, das man Marina in Madrid anmass, war nach einer Woche schon zu gross, «weil ich wieder mit der Arbeit angefangen hatte! Wir sind Athleten. Alles muss trainiert werden.»
Ihr nächstes grosses Wagnis, diesmal in Valencia, ist die Rolle der Cio-Cio San in Puccinis Madama Butterfly, «ein fünfzehnjähriges Mädchen!» Und wovon träumt sie auf längere Sicht? Von weniger Flugreisen: «Wir warten auf die Rail Baltica!» Diese Hochgeschwindigkeitsstrecke wird von Tallinn bis Warschau führen. Sie strahlt. «Dann kommt man über Nacht von Riga nach Berlin!»
Das Gespräch führte Volker Hagedorn.
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 86, Oktober 2021.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
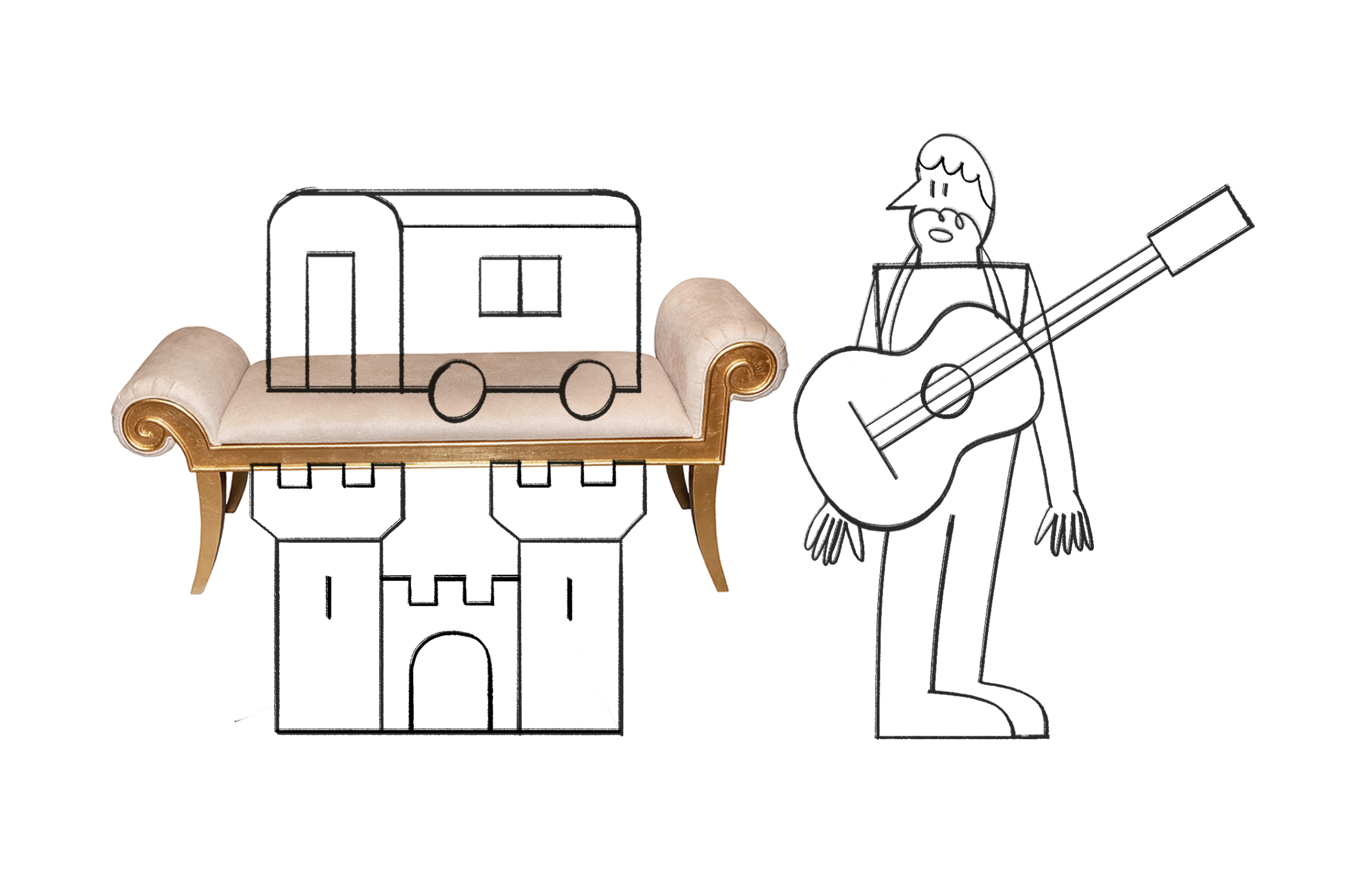
Manrico aus Giuseppe Verdis «Il trovatore»
Auf der Couch
Die Handlung von Il trovatore spielt zwar im ausgehenden Mittelalter mit Klöstern Burgen und Rittern. Aber die sozialen Spannungen des 19. Jahrhunderts kann in diesem Textbuch jeder sehen, der sie sehen will. Es geht um den Kampf zwischen dem Bürgertum und der nach Napoleons Niederlage erstarkten, in ein primitives, ja grausames Licht getauchten Feudalherrschaft.
Damit eine romantische Geschichte daraus wird, ist der Trovatore Manrico ein entführter Prinz, Ziehsohn einer Zigeunerhexe und Bruder des Fürsten von Aragon. Wie viele adoptierte Kinder, die nicht von Anfang an über ihre Vergangenheit aufgeklärt werden, fühlt sich Manrico zwischen Baum und Borke, ein Kämpfer der in Turnier und Duell den Adeligen nicht nur Paroli bietet, sondern edler im Gemüt ist als diese. Dieser Held hat sich selbst in seiner Kunst gefunden. Seine mächtigsten Verbündeten sind die Frauen sein ärgster Feind ist er selbst, denn die frühe Belastung des Selbstgefühls führt dazu, dass Eifersucht nicht verarbeitet werden kann. Wer heimatlos wurde, sucht in der Liebe das Absolute und handelt im Liebeszweifel impulsiv. Ein sprechendes Beispiel ist Othello.
Das romantische Skript ignoriert energisch die feudale Realität, in der die Dame des Herzens zwar in einen Liebeshimmel gehoben, aber keineswegs angefasst werden durfte. Die fahrenden Sänger des Mittelalters haben die romantische Liebe als spirituelle Minne erfunden, aber erst im 19. Jahrhundert dürfen sich beispielsweise Käthchen von Heilbronn und ihr Ritter in die Arme nehmen (und auch das nur, weil Käthchen des Kaisers uneheliche Tochter ist).
Im 19. Jahrhundert wird der triviale Liebes und Schicksalsroman populär. «Zigeunerinnen» entwickeln eine gerade zu teuflische Neigung, hochgeborene Kinder zu entführen. Diese wachsen zu rätselhafter Blüte, Tugend und Schönheit heran und fühlen sich dem fahrenden Volk gleichzeitig zugehörig und nicht zugehörig. Dann kommt, was kommen muss: eine Person «von Stand» mit Schloss und Titel verliebt sich in ein Geschöpf, dessen Wurzeln so gar nicht zur Blüte passen. Und ehe alles kaputt geht, wird dann doch die Grafenkrone in der Windel entdeckt, die eine reuige Ziehmutter aus der Truhe kramt.
Freud hat dieses Motiv als narzisstische Fantasie denunziert («Familienroman der Neurotiker»). Das Kind wünscht sich fürstliche Eltern, allzu gering erscheinen ihm Mutter und Vater. Aber die Deutung lässt sich ausweiten zu dem zentralen Motiv der Romantik: einer Antwort auf die Belastung des Selbstgefühls. Die Fantasie, in der Liebe festen Halt und Sicherheit zu finden, winkt als happy end, schenkt Hoffnung in unsicheren Zeiten, in denen das Ich höher gehoben, aber auch tiefer gestürzt werden kann als in traditioneller Enge. Was die gesellschaftliche Entwicklung unwiederbringlich zerstört hat, wird nachträglich als Paradies idealisiert.
So blickt das bürgerliche Ich, dem alle Möglichkeiten offenstehen, auch die, an den eigenen Ansprüchen zu scheitern, sehnsüchtig nach der Welt des Adels, in der man allein durch Geburt schon Prinz ist oder Prinzessin. Im 19. Jahrhundert wird nicht nur das fahrende Volk, etwa in Gestalt Carmens, zum Symbol riskanter Freiheit. Auch der Troubadour erscheint als ein Vorläufer des modernen Ich, selbst bewusst und stolz in seiner Kunst und doch angewiesen auf die Gnade einer Gesellschaft, die ihn in guten Zeiten rühmt und nährt, in schlechten aber im Stich lässt.
Text: Wolfgang Schmidbauer, Psychoanalytiker und Buchautor
Illustration: Anita Allemann