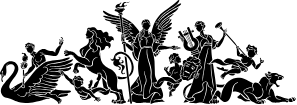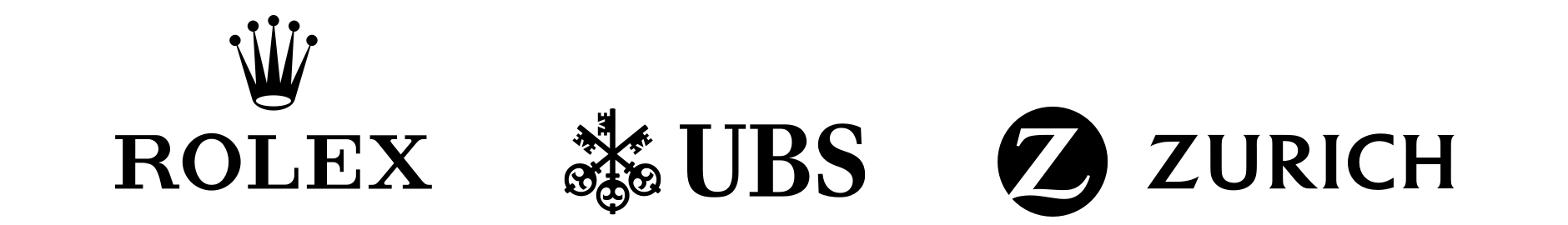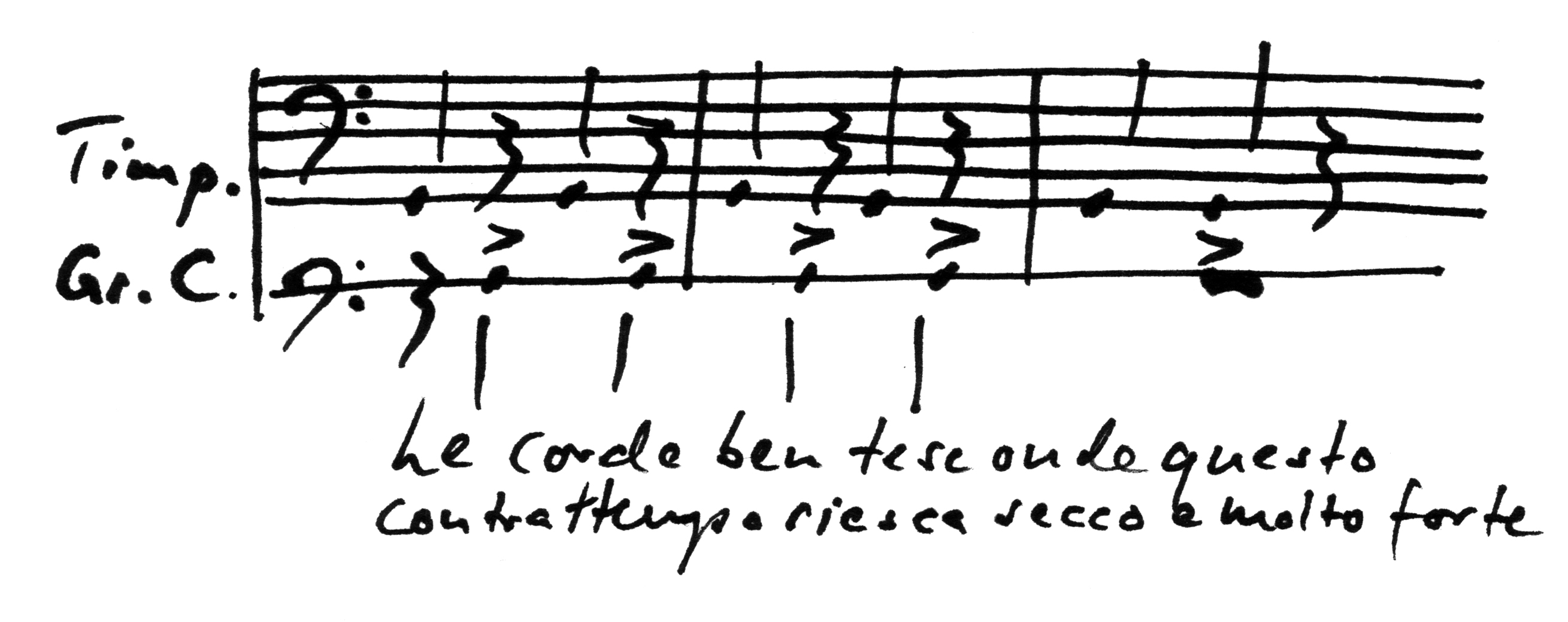Früher wartete nach dem Tod die metaphysische Ewigkeit auf den Menschen. Im Zeitalter der aufgeklärten Moderne aber ist er mit sich und seiner Endlichkeit allein. Welcher Trost bleibt dann?
Mit dem Tod können wir nicht leben. Wir sind Kinder der Moderne, und über diese heisst es zu Recht, dass sie ihre Sterblichkeit verdrängen, verleugnen und vergessen müssen. Der Tod ist ihnen so fremd, wie ihnen nur etwas fremd sein kann. Sie tun alles, um ihm ein Schnippchen zu schlagen. Sie laufen vor ihm davon und machen sich aus dem Staub. Früheden religiösen Weltbildern, besass der Tod noch einen unverrückbaren symbolischen Ort. Er war Teil des Absoluten – der Tod war bedeutsam, er war grösser als der Mensch.
Im Denken und Fühlen der Moderne ist für diese Vorstellung kein Platz mehr. Das nachreligiöse Bewusstsein ist mit sich und seiner Endlichkeit allein, es gibt darin kein metaphysisches Drittes, keine göttliche Ewigkeit, die Leben und Tod sinnstiftend überwölbt. Der aufgeklärte Tod ist nur noch der eigene, radikal subjektive – ein natürliches Übel und nichts sonst. Mit anderen Worten: In der Moderne hat der Tod keine Verbindung zu einem kosmischen Absoluten, er ist nicht mehr «draussen», er ist nun «drinnen», ein Vorkommnis im banalen Lauf der Welt. In dem Stück Sieben Türen. Bagatellen von Botho Strauss grüsst eine Figur den verdrängten Tod wie einen alten Bekannten und ist doch tödlich enttäuscht. Der Tod ist nicht mehr der «grosse Tod» der abendländischen Metaphysik; er ist ein moderner Zeitgenosse, ein unscheinbares «Männlein» und «unendlich durchschnittlich», so zeigt ihn Strauss in Sieben Türen. Wer in der Moderne stirbt, der ist wirklich tot.
Die grossen Aufklärer, zum Beispiel Gotthold Ephraim Lessing oder das philosophische Genie Immanuel Kant, machten sich keine Illusionen darüber, dass ihre Religionskritik das Problem des Todes nicht zum Verschwinden bringt, sondern vielmehr noch verschärft. Wenn der Tod seinen metaphysischen Ort in einem Grossen und Ganzen verliert und nicht länger durch eine religiöse Erzählung gebannt wird, dann vagabundiert die Angstdurch unser Bewusstsein und tritt die Herrschaft über die Gedanken an. Der aufgeklärte Tod wird zum Dämon der Lebendigen, und uns bleibt nichts anderes übrig, als ihn in säkularer Einsamkeit stoisch zu ertragen. «Die Faktizitäten von Krankheit und Tod», so schreibt der Philosoph Jürgen Habermas ernüchtert, können nicht «hinweginterpretiert», sie können nur ins Bewusstsein gehoben und «prinzipiell trostlos» ausgehalten werden. Dasselbe, so müsste man ergänzen, gilt für das unerträgliche Dazwischen, für die Zeit zwischen Nicht-Mehr-Leben und Noch-Nicht-Sterben-Können. Es gilt für das langsame Schwinden des Bewusstseins, für Verdämmern und Siechtum, überhaupt für den Verlust von Selbstbestimmung und Autonomie.
Und doch wäre es hilflos und ungerecht, allein die (historisch unvermeidliche) Religionskritik für die Angst vor dem Tod verantwortlich zu machen. Es ist nämlich die Logik der modernen Gesellschaft selbst, die Sterben und Tod zum Skandal macht. Die moderne Gesellschaft ist eine einzige Vorwärtsbewegung, sie ist vernarrt in ihre Rationalität, sie rast nach vorn und lebt von der progressiven Entfesselung ihrer kinetischen Energien. Nichts also ist ihr unheimlicher als der Einbruch der Endlichkeit in die Unendlichkeit ihrer göttlichen Vernunft, nichts provoziert die Moderne mehr als die absolute Negativität am hellen Morgen der Zukunft.
Die Nützlichkeitsmoderne kann den Tod nicht gebrauchen, er wirkt auf sie wie ein Angriff der Natur auf ihr edelstes Geschöpf. Schon Goethe hatte erkannt, wie schwer es dem modernen Vernunftglauben fällt, dem Tod ins Gesicht zu sehen und ihm in Würde standzuhalten. In einer berühmten Szene in seinem Roman Wilhelm Meisters Lehrjahre (1795) beschreibt er, wie herzlos die Turmgesellschaft mit dem Tod von Mignon und dem Harfner verfährt. Diese beiden Gestalten ragten wie Widergänger einer längst versunkenen Vergangenheit in die Gegenwart des Romans, und mit ihren «unvernünftigen» romantischen Leidenschaften konnte die kühl kalkulierende Turmgesellschaft nichts mehr anfangen. Im «Saal der Vergangenheit» werden die Toten abgelegt und die Erinnerung an sie mumifiziert. Gedächtnis ist hier aktives Vergessen; die Modernen befreien sich nicht nur vom Andenken an zwei Menschen. Sie befreien sich von einem Ärgernis des Lebens: Sie befreien sich vom Tod.
Inzwischen mehren sich allerdings die Stimmen, die lebhaft der Behauptung widersprechen, die Moderne sei eine Meisterin der Verdrängung. Die Verdrängungsthese entspringe dem typischen Selbsthass der Moderne, deren Insassen nur dann glücklich seien, wenn sie sich selbst verachteten. Den Einwand muss man ernst nehmen. In der Tat gibt es auf dem Feld der Kunst eine «neue Sichtbarkeit des Todes» (so die Kulturwissenschaftler Kristin Marek und Thomas Macho), es gibt hochreflektierte Versuche von Künstlern, das existentiell Verdrängte in den öffentlichen Raum zurückzuholen.
Und noch stärker ins Auge fällt die «neue Sichtbarkeit des Todes» in den Bildwelten des Internets. Selbstgestaltete Webseiten versammeln Zeugnisse und Erinnerungen an die Verstorbenen, und auf digitalen Grabstätten «leben» sie mit Hilfe von Fotos und Videos im Gedächtnis der Angehörigen weiter. Mit rührender Trauer werden sie in die Gegenwart zurückgeholt, als seien sie nie gestorben und noch immer mitten unter uns.
Es stimmt schon, dass die neue Sichtbarkeit des Todes auf einen Bewusstseinswandel in der Gesellschaft verweist und eine positive Veränderung der öffentlichen Wahrnehmung dokumentiert. Und doch gibt dieser Bewusstseinswandel, der sich vor allem im Internet zeigt, keine Auskunft darüber, ob er die Kraft hat, der säkularen Verdrängung ein Ende zu bereiten und gleichsam als Religionsersatz die Angst vor dem Tod zu mildern. Wer vermöchte schon zu sagen, ob die neuen Trauerrituale, also die virtuelle Anwesenheit der Verstorbenen auf den Bildschirmen der Angehörigen, deren realen Verlust nicht noch schmerzhafter macht?
Wer die Trauerbekundungen auf digitalen Erinnerungsseiten liest oder jene Rituale betrachtet, mit denen die Toten auf dezidiert nichtkirchlichen Beerdigungen zur letzten Ruhe geleitet werden, der stösst immer wieder auf eine gleichlautende tröstende Formel: Der Tod, so heisst es, sei ein natürlicher Bestandteil der Evolution, er sei die unhintergehbare Konsequenz physikalisch vergehender Zeit. Der Verstorbene verlässt die Erde und taucht wieder ein in den Fluss der natürlichen Zeit.
Nicht zufällig erinnert die Anrufung von «Natur» und «Zeit» an die vorchristliche Antike. Der römische Dichter Lukrez zum Beispiel beruhigte sich mit dem Gedanken, dass niemand Anstoss daran nehme, vor seiner Geburt nicht auf der Welt gewesen zu sein; kein Mensch beklage sich über die lange Periode seiner vorgeburtlichen Nicht-Existenz. Lukrez folgerte daraus: Wenn niemand die Zeit vermisst, die er früher nicht gelebt hat, dann müsse man auch vor dem natürlichen Tod keine Angst haben – die Zeit, die nach dem Leben kommt, ist nichts anderes als das Spiegelbild jener Unendlichkeit, die unserem Leben voraus liegt. Wir kommen aus der Zeit, und wir gehen in sie zurück. Im Übrigen spüre man im Augenblick des Todes den Verlust des Lebens gar nicht mehr. Im Tod stirbt naturgemäss auch das empfindsame Subjekt, das grundlos vor ihm Angst hatte.
Es fragt sich, ob die Versicherung, der Tod sei nur eine übliche Erscheinungsart der Natur, die Untröstlichen wirklich tröstet. Erleichtert die naturalistische Auskunft, unser Leben sei ein blosses Intermezzo im kosmischen Spiel der Evolution – erleichtert sie tatsächlich den Abschied von der Welt? Mildert sie die Trauer beim Tod eines nahestehenden Menschen? Der amerikanische Philosoph Thomas Nagel glaubt das nicht. Zwar könne kein vernünftiger Mensch bestreiten, dass Sterben und Tod Teil der Evolution seien, doch der Verweis auf die objektive Macht der Natur erfasse bloss die biologische Aussenperspektive, die mit dem inneren Selbsterleben der Menschen nicht verwechselt werden dürfe. Menschen, so Nagel, erleben sich nicht als Teil der Evolution, sie fürchten sich auch nicht vor dem Zustand des Totseins, sie fürchten sich vor dem Verlust des Lebens und dem Ende der Erfahrung. «Der Tod nimmt uns etwas Wünschenswertes», und über diesen Verlust könne uns kein Naturalismus hinweghelfen. Der Trost, dass der Mensch sterblich und der Tod ein Bestandteil der Evolution ist – dieser Trost ist trübe. Verlust und Trauer lassen sich nicht naturalisieren.
Thomas Nagels Unterscheidungen sind hilfreich. Wenn es stimmt, dass der Verweis auf die Natürlichkeit des Todes («alle Menschen müssen sterben») uns nicht zu trösten vermag, weil er unserem inneren Selbsterleben widerspricht, dann muss man sagen: Der Tod ist ein Doppelwesen. Er ist Teil der Natur – und gleichzeitig Teil der Gesellschaft, ein Teil ihrer Kultur.
Das muss man erklären. Der Umstand, dass Sterben und Tod natürlich sind, ist eine unsterbliche Trivialität. Aber warum ist das Verstehen des Todes zugleich gesellschaftlich? Die Antwort klingt paradox: Weil der Tod vollkommen unverständlich ist und jeder Versuch, ihn in Worte zu fassen, scheitern muss. Der Tod bleibt unvorstellbar, er entzieht sich jeder Beschreibung und jeder Repräsentation; niemand vermag über ihn zu sprechen, denn in dem Moment, in dem man es könnte, ist man ja schon tot. Anders gesagt: Das Unausdenkbare des Todes lässt sich nur in einer sprachlosen Sprache umkreisen, in den Klang und Bilderwelten von Musik und Literatur, von Kunst und Religion, kurz: in den Vorstellungswelten, die wir im kulturell Imaginären der Gesellschaft immer schon vorfinden. Entscheidend ist darum weniger, dass der Tod in der Gesellschaft sichtbar ist; entscheidend ist, wie er sichtbar ist: Je reicher der kulturelle Bilderschatz, desto artikulierter ist unsere Auseinandersetzung mit dem Unausdenkbaren. Gewiss können kulturelle Bilder eine existenzielle Angst nicht beseitigen. Aber sie alphabetisieren den Schmerz, sie machen ihn «namhaft» und identifizieren ihn.
Damit soll nicht behauptet werden, die Wahrnehmung des Todes geschehe einzig und allein in der kulturellen Wahrnehmung, im Ätherreich von Metaphern, Weltbildern und Vorstellungen. Nein, sie entsteht zugleich in der harten Realität einer arbeitsteiligen Gesellschaft, denn sie ist es, die unser praktisches Verhältnis zur Zeit und zur Vergänglichkeit organisiert. Heute, so lautet der weithin unstrittige Befund, leben wir in einer Optionsgesellschaft, in der sich zwischen Gegenwart und Zukunft nicht mehr scharf trennen lässt. Immer stärker fliessen die «Zeitzonen» ineinander, die Gegenwart ist nicht mehr nur Gegenwart, sie ist zugleich der Optionsraum der Zukunft, und das heisst: Die Zukunft ist immer schon anwesend und muss in ihren Chancen und Gefahren ständig antizipiert, sondiert, kalkuliert und stabilisiert werden. Was muss ich heute tun, damit meine Gegenwart in der Zukunft noch dieselbe ist wie in der Vergangenheit?
Das klingt harmlos, aber es verändert unser Zeitempfinden gegenüber früheren Generationen tiefgreifend. Goethe hatte der heraufziehenden Nützlichkeitsmoderne die Rechnung aufgemacht und nannte sie «Zeit der Einseitigkeit»; gleichwohl aber waren für ihn die Grenzen zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft klar gezogen. Das lässt sich von der Digitalmoderne nicht mehr behaupten. Wir empfinden die Gegenwart nicht als ein abgeschlossenes Hier und Jetzt; wir empfinden sie als Möglichkeitsraum, als zeitlosen Konjunktiv und Vor-Fall des Künftigen in die «Fülle des Augenblicks». Es ist wie an der Börse: Die Gegenwart verwandelt sich in das spekulative Noch-Nicht der Zukunft. Das Präsens des Lebens wird flüssig – im schlimmsten Fall wird das Da-Sein als existenzielle Intensität gar nicht mehr empfunden, geschweige denn gelebt.
Es liegt auf der Hand, dass sich damit unser Verhältnis zu Zeit und Frist noch einmal verändert: Wer das Gefühl hat, die Gegenwart sei nichts anderes als eine Übergangspassage in die Zukunft, für den radikalisiert sich die Frage nach Tod und Endlichkeit. Und je abstrakter und körperloser unsere Arbeit, desto stärker wird das Gefühl, gar nicht richtig gelebt zu haben, und der biblische Satz, man sterbe «alt und lebenssatt», klingt dann seltsam anachronistisch. Der Tod ist nicht mehr der Endpunkt eines erfüllten Lebens. Er ist ein Optionenkiller, der jäh und ungerecht in den Möglichkeitsraum der Gegenwart einfällt.
Ist es Zufall, dass das Evangelium des Transhumanismus so erstaunlich viel Anklang findet? Jene Erlösungsbotschaft, die von den Utopiemanufakturen des Silicon Valley unters Volk gebracht wird und verspricht, das Leiden an der Zeit zu beenden? Der Transhumanismus arbeitet an der Unsterblichkeit und predigt den Sterblichen: Vergesst Euren analogen Körper, er ist eine Fehlkonstruktion der Schöpfung. Was vom Menschen bleibt, sei allein sein unvergänglicher Geist. In naher Zukunft schon werde man den Geist aus unseren Hirnen per Upload in einen Roboter hochladen, so dass wir in einer menschlichen Maschine alterslos weiterleben bis in alle Ewigkeit, glücklich wie am ersten Schöpfungstag. Die Science-Fiction-Science der Transhumanisten organisiert die Flucht aus der Endlichkeit und beweist damit nur, dass der Tod in der Moderne genau die Gewalt ist, die er immer schon war. Wenn nicht alles täuscht, dann besteht der einzige Trost nun darin, diese Trostlosigkeit immer wieder neu und immer wieder anders ins Bewusstsein zu heben – mit Hilfe jener Bilder, Metaphern und Melodien, die Künstler, Schriftsteller und Musiker in Einsamkeit und Freiheit der menschlichen Endlichkeit abgerungen haben.
Ein Text von Thomas Assheuer.
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 44, Dezember 2016.
Das MAG können Sie hier abonnieren.