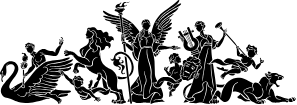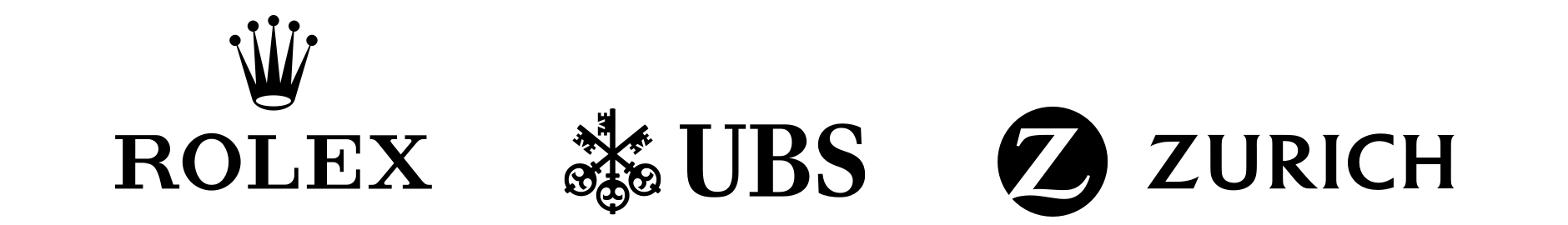«Nabucco» ist die Erfolgsoper des jungen Verdi. Ausgehend vom Konflikt zwischen den Babyloniern und den Hebräern entwickeln Andreas Homoki und Fabio Luisi ein Familiendrama mit der Königstochter Abigaille im Zentrum. Ein Gespräch aus dem Jahr 2019 über die Kühnheiten des Dramatikers Verdi, die in «Nabucco» zum ersten Mal zum Ausdruck kommen.
Andreas Homoki und Fabio Luisi, mit Nabucco bringt ihr gemeinsam die erste grosse Erfolgsoper von Giuseppe Verdi auf die Bühne. Was macht den jungen Opernkomponisten Verdi eurer Meinung nach attraktiv?
Fabio Luisi: Unter Verdis frühen Opern ragt Nabucco als ein besonders reifes Werk hervor – reif nicht einmal in musikalischer, sondern vor allem in dramaturgischer Hinsicht. Verdi lehnt sich zwar an Vorbilder wie Donizetti und Bellini an, entfernt sich aber zugleich von ihnen: Er begreift, dass Oper nicht nur eine musikalische Umschreibung von Ereignissen oder eine Zurschaustellung vokaler Virtuosität ist, sondern Theater. Viele Regisseure tun sich ja schwer mit dem dramatischen Rhythmus von Belcanto-Opern, weil selbst bei sehr gut strukturierten Werken wie beispielsweise Donizettis Lucia di Lammermoor das Augenmerk mehr auf den retardierenden Momenten als auf dem Vorantreiben der Handlung liegt. Mit Nabucco entwickelt Verdi eine ganz neue Einstellung: Hier wird das Essenzielle fokussiert und mit grosser, atemloser Spannung erzählt. Diese Oper ist ein Geniestreich und der Beginn eines Modells, an das Verdi später sehr erfolgreich angeknüpft hat.
Andreas Homoki: Dem kann ich nur zustimmen! Verdis Fokus aufs Wesentliche kommt mir als Regisseur sehr entgegen. Er kümmert sich in Nabucco beispielsweise überhaupt nicht darum, Situationen durch ausgeklügelte Hintergrundinformationen plausibel zu machen. Er lässt die Hintergründe und Motivationen des Geschehens sogar ganz bewusst und konsequent unscharf. Informationen, die nicht die augenblickliche Handlung betreffen, sondern bereits Geschehenes kolportieren, werden ganz schnell abgehandelt und manchmal fast grotesk verkürzt, mit dem Ziel, sofort wieder im dramatischen Jetzt-Moment zu sein. Diese zugespitzte Erzählweise reizt mich als Regisseur sehr, ist aber auch herausfordernd, weil man gezwungen ist, eine Form zu finden, die nicht naturalistisch ist, sondern ganz auf die Regeln des Theaters vertraut. Die Personen treffen wie Spielfiguren aufeinander und müssen aus dem jeweiligen Moment heraus ihre ganze Wirkung entfalten.
Diese Wirkung entfalten sie aber nicht nur in dramatischen Szenen, sondern auch in reflektierenden Arien. Sind das die Momente, die noch eher an die musikalischen Vorgänger Verdis erinnern?
Homoki: Verdi geht von der Form seiner Vorgänger aus, konzentriert sich aber stark auf die Figuren und geht – in Nabucco ganz besonders – ziemlich rücksichtslos gegen Konventionen und Erwartungen vor. Dafür wurde er von einigen Kritikern auch angegriffen und als roh und ungehobelt gescholten. Andererseits wusste Verdi natürlich genau, dass er die Virtuositätsansprüche bedienen und effektvolle Arien schreiben muss, um erfolgreich zu sein.
Luisi: Verdi wollte nicht unbedingt ein Revolutionär sein! Bis zum Erfolg des Nabucco war er ein wenig beachteter junger Komponist. Sein primäres Ziel war es deshalb, eine gute Oper zu schreiben. Allerdings hat er einen wesentlichen Punkt schon damals gut begriffen, nämlich, dass die Kunst nicht im Hinzufügen, sondern im Weglassen besteht. Er bündelt all seine Energie in den Figuren, ihren Emotionen und einer spannungsgeladenen Handlung. Die Konventionen seiner Vorgänger sind also formal noch da, aber nicht mehr wegweisend.
Der Librettist Temistocle Solera ist in Nabucco mit historischen und biblischen Fakten des Stoffes sehr frei umgegangen. Worum geht es im Kern?
Homoki: Um es einmal anders aufzuzäumen, als man es erwarten würde: Es ist die Geschichte einer Familie, nämlich die Geschichte Nabuccos, der zwei Töchter hat. Als Anführer des babylonischen Reichs war dieser Vater einst ein einflussreicher Machtmensch. Doch nun wankt sein System, ihm schwinden die Kräfte, und dem polytheistischen System der Babylonier steht als Utopie ein neues, moderneres System gegenüber, nämlich die monotheistische Weltanschauung der Hebräer. Der persönliche Familienkonflikt findet also vor dem Hintergrund eines grossen Umbruchs statt. Es bricht eine neue Zeit an, welche Babylon letztlich zum Einsturz bringen wird. Abigaille, die vermeintlich erstgeborene Tochter Nabuccos, versucht verzweifelt, das alte System zu retten, indem sie den Vater vom Thron stürzt und selber die Macht übernimmt. Fenena, die andere Tochter, spürt die Zeitenwende und wechselt «die Seiten». An diesem Ablösungsprozess des Alten durch das Neue zerbricht letztlich auch diese Familie. Abigaille ist die Verliererin, weil sie den Untergang des alten Systems nicht aufhalten kann. Wie so oft bei Verdi wird auch hier gezeigt, wie eine Familie durch die Verstrickungen in einen politischen Kontext zerrissen wird.
Das tragische Schicksal der Abigaille scheint Verdi stärker interessiert zu haben als das zukunftsweisende der Fenena. Zwar gibt es in dieser Oper – was bei Verdi selten ist – mit Fenena und Ismael ein Liebespaar, das am Ende auf eine gemeinsame Zukunft hoffen darf. Im Vergleich zu Abigaille sind diese beiden Partien aber relativ klein ausgefallen...
Homoki: Bei der Ausarbeitung der Szenen stelle ich immer wieder fest, dass Abigaille das Zentrum des Stückes bildet. Diese Oper ist die tragische Geschichte der Abigaille, und so werden wir das auch zeigen. Was ich an Verdi so bewundere, und was ihn auszeichnet, ist die Empathie, die er für jede seiner Figuren empfindet. Er bezieht keine Stellung für oder gegen sie, und er verurteilt Abigaille nicht als «machthungrige Furie», wie das fälschlich oft interpretiert wird.
Luisi: Abigaille ist eine ganz grosse Persönlichkeit, eine intelligente und instinktive Kämpferin. Sie hat Züge, die wir später in Verdis Schaffen bei Lady Macbeth oder bei Manrico im Trovatore wiederfinden, sie besitzt eine unglaubliche animalische Kraft. Für Verdi als Komponisten ist ein solcher Charakter natürlich hochattraktiv. Es ist interessant, die Partien von Abigaille und Nabucco musikalisch zu vergleichen, denn die Musik unterstreicht auch den Stand ihrer Macht: Nabuccos Herrschaftsposition ist breit abgestützt, weshalb seine Musik auch eher in die Breite geht. Abigaille hingegen kämpft um ihre Position, was sich musikalisch in vertikalen, völlig überspitzten emotionalen Ausbrüchen äussert.
Homoki: Aber sie hat auch eine ganz weiche Seite, die in ihrer ersten Arie durchbricht, wenn sich herausstellt, dass sie in den gleichen Mann verliebt ist wie ihre Schwester.
Luisi: Das zeigt, wie verletzlich sie eigentlich ist und woher ihre Härte kommt: nämlich aus der privaten Situation, dass sie als Liebende und später auch noch als nichtleibliche Tochter Nabuccos zurückgewiesen wird.
Homoki: Wobei diese Unterscheidung in eine echte und eine falsche Tochter für mich nicht ins Gewicht fällt. Das ist nur eine kleine Zusatzinformation, die Verdi zu Beginn des zweiten Akts einstreut, die aber gleich in den dramatischen Ereignissen untergeht, welche für mich die eigentlich spannenden Momente des Stücks ausmachen. Entscheidend ist für mich, dass die eine Tochter nicht akzeptiert, dass die Zeiten sich ändern, während die andere versteht, welche Richtung die Veränderungen nehmen.
Macht ist ein Thema, das nur wenige Jahre später in Macbeth ins Zentrum von Verdis Interesse rückt. Liegt sein Augenmerk auch in diesem Stück schon auf den Fragen der Macht?
Homoki: Nein, jedenfalls kommt es in diesem Stück nicht zu Machtkämpfen, die mit Waffen entschieden werden müssen. Die Macht hat man, oder man hat sie nicht. Das wird auch in der Inszenierung sehr zeichenhaft die Königskrone zeigen.
Luisi: In Macbeth zeigt Verdi dann, wie man an die Macht kommt, aber auch wie fragil sie ist, wie kompromisslos man sich ihr verschreiben muss und wie sich Macht durch diese brutale Konsequenz selbst zerstört. In Nabucco sind die Machtverhältnisse hingegen nur eine Nebenschiene dieser Familientragödie, aus deren Spannungsfeld sich das ganze Stück entwickelt.
Homoki: Dieses Spannungsfeld ist für die Inszenierung ganz zentral. Ohne den Fokus auf diesen familiären Konflikt wäre es schwierig, die Motivation der Figuren zu zeigen, besonders dann, wenn sich der Kontrast – was ja immer wieder geschieht – immens vergrössert und durch den Chor, der die beiden Völker der Babylonier und Hebräer repräsentiert, ins Monumentale gesteigert wird.
Dem Chor kommt in dieser Oper eine tragende Rolle zu. Die Szene der in Babylon gefangenen Hebräer, die ihr Schicksal beklagen, der «Gefangenenchor», gehört zu den bekanntesten Stücken von Verdi überhaupt. Oft wurde der Wunsch nach Freiheit, der darin zum Ausdruck kommt, mit dem Willen des italienischen Volkes in Verbindung gebracht, das 1842, im Jahr der Nabucco- Uraufführung, selbst unter der Fremdherrschaft der Österreicher gelitten hat. Fabio, wie stehst du als Dirigent und als Italiener zu dieser Thematik?
Luisi: Dass man Nabucco und insbesondere den Gefangenenchor für politische Zwecke vereinnahmte, hat bereits zu Verdis Lebzeiten begonnen. Dass der Chor in der Folge gar als «heimliche Nationalhymne» Italiens bezeichnet wurde, finde ich aber absurd, denn ein Chor von Gefangenen kann keine Hymne sein. Die Diskussion, «Va pensiero» zur Nationalhymne von Italien zu machen, ist sehr alt – zum Glück ist es nie dazu gekommen!
Trotzdem ist der Gefangenenchor in seiner Rezeptionsgeschichte immer wieder als Zeichen des Widerstands gegen die politische Fremdbestimmung gedeutet worden. Ein prominentes Beispiel findet sich in der Sissi-Trilogie mit Romy Schneider: Als die österreichische Kaiserin die Scala in Mailand besucht, stimmt das Publikum als Protest den «Va pensiero»-Chor an...
Luisi: Diese Abneigung gegenüber der österreichischen Fremdherrschaft gab es in Mailand tatsächlich. Und Verdi, der mit seiner Musik starke Emotionen auslöste, wurde im Lauf der Zeit zu einer wichtigen Identifikationsfigur der italienischen Unabhängigkeitsbewegung stilisiert. Diese Bestrebungen, die österreichische Fremdherrschaft abzustreifen und eine neue Ordnung herbeizuführen, begannen in Italien unmittelbar nach dem Fall Napoleons, also genau in der Zeit, in der Verdi aufgewachsen ist...
... und in dieser Hinsicht ist die Parallele zwischen der Epoche, in der die Handlung von Nabucco angesiedelt ist, und dem Zeitalter Verdis natürlich interessant. Andreas, inwiefern hat das historische Italien des 19. Jahrhunderts eine Bedeutung für die Inszenierung?
Homoki: Den Hintergrund für die privaten Konflikte dieses Stücks bildet, wie wir gesehen haben, die Polarität zwischen einer alten und einer neuen Ordnung. Es war uns wichtig, diesen Kontrast, der sich besonders deutlich über die beiden Chorgruppen erzählen lässt, auch ästhetisch stark hervorzuheben. Und so kam ich zusammen mit meinem Bühnen und Kostümbildner Wolfgang Gussmann auf die Idee, den Gegensatz zwischen dem Bürgertum und der als Fremdherrschaft empfundenen Aristokratie in der Zeit Giuseppe Verdis zu zeigen. Es geht uns dabei aber nicht um historischen Realismus oder eine konkrete zeitliche Verortung, sondern um einen ganz plakativen, scharfen Gegensatz. Der Konflikt zwischen der sich restaurierenden Aristokratie und dem Zurückdrängen der bürgerlichen Kräfte ist ein beherrschendes Europa-Thema des frühen 19. Jahrhunderts; in unserer Inszenierung zeigen wir diesen Konflikt als eine Art Parabel über den Fortschritt...
Luisi: Bei Verdi geht es immer um den Fortschritt. Das sehen wir später auch deutlich in Werken wie I vespri siciliani, Don Carlo oder Simon Boccanegra. Es geht immer um die Idee einer neuen Freiheit, die der alten und verkrusteten Art, ein Volk zu führen, entgegengesetzt ist.
Homoki: Verdi scheint politisch viel bewusster zu denken als seine Vorgängerkollegen, denen es oft reichte, ihre Handlung in einem konfliktreichen Millieu anzusiedeln, wie beispielsweise Bellini in I puritani...
Luisi: In I puritani wird die Ordnung als unveränderbar dargestellt. Bei Verdi hingegen wird sie immer in Frage gestellt. Die Charaktere stehen bei ihm für die verschiedenen Richtungen: Abigaille für das Festhalten an der alten Macht, die Hebräer für den Gedanken der Freiheit.
Eine grosse Partie hat Verdi für Zaccaria, den geistigen Führer der Hebräer, komponiert. Durch seine tiefe Gläubigkeit stärkt er den Mut und die Hoffnung seines geknechteten Volks...
Homoki: Zaccaria und der Oberpriester des Baal sind für uns nur Repräsentanten der jeweiligen Ordnungen. Die Partie des Baal-Priesters ist viel kleiner, weil er der Sprecher der reaktionären Fraktion ist: er muss seine Ordnung nicht erklären, weil sie die bestehende ist. Zaccaria repräsentiert hingegen die Seite, die für Verdi sympathischer ist, nämlich die neue Idee der Zukunft. Zaccaria formuliert diese neue Ordnung und treibt sie voran. Das bewegt Verdi zu einer grösseren, ausführlicheren Partie, die von uns auch mit mehr Empathie begleitet wird.
Die Geschichte hat uns gezeigt, dass neue Ordnungen nicht immer mit Erfolg einhergehen und nicht immer die besseren sind. Im Nachhinein wurde etwa auch an der Risorgimento-Bewegung kritisiert, dass sie von einer elitären Minderheit und unter geringer Beteiligung der Bevölkerung durchgesetzt wurde. Ist Verdi sich dessen bewusst, wenn er seine Oper mit dem Tod Abigailles tragisch enden lässt?
Luisi: Nein, soweit denkt Verdi als junger Enthusiast nicht. Er vertritt in Nabucco einen idealistischen Standpunkt: Die Tatsache, dass eine neue Ordnung sich gegen eine alte durchsetzen kann, ist für ihn per se positiv.
Das Gespräch führte Fabio Dietsche.
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 70, Juni 2019.
Das MAG können Sie hier abonnieren.