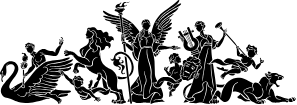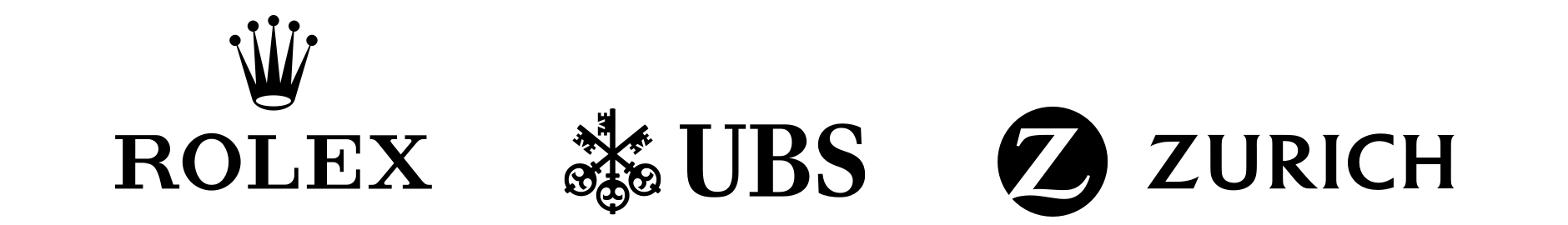Der russische Star-Choreograf Alexei Ratmansky rekonstruiert mit dem Ballett Zürich das berühmteste aller klassischen Handlungsballette. Ballettdramaturg Michael Küster führte mit ihm vor der Premiere 2016 ein Gespräch über das Abenteuer, eine Ikone des historischen Balletts in neuem Glanz erstrahlen zu lassen.
Alexei Ratmansky, selbst Nicht-Ballettfans bekommen leuchtende Augen, wenn von Schwanensee die Rede ist, gilt es doch als Inkarnation des klassischen Balletts schlechthin. Worin besteht für Sie der Mythos Schwanensee?
Da kommen ganz viele Faktoren zusammen. Da ist die faszinierende Symbolik der Dualität von Weiss und Schwarz. Da ist die Mischung aus grossen Gefühlen und fantastischen Tableaux, archetypischen Fantasien und stupender Technik, die sich vor dem Hintergrund von Tschaikowskis sensibler und hochemotionaler Musik entfaltet. Schwanensee ist eine der ersten grossen Ballettpartituren. Von einigen französischen Ausnahmen abgesehen, hatte es so etwas noch nicht gegeben. Bis dahin hatte man es im Ballett zumeist mit zweitklassiger Musik zu tun. Tschaikowskis Komposition ist hingegen ein sinfonisch-dramatisches Kunstwerk. Die Erstfassung von Schwanensee, die 1877 am Moskauer Bolschoi-Theater herausgekommen war, hatte noch nicht die durchschlagende Wirkung der als Gemeinschaftsarbeit von Marius Petipa und Lew Iwanow entstandenen Fassung von 1895. Für beide war Schwanensee der Höhepunkt ihrer langen Karrieren. Das Libretto von Wladimir Begichev, dem späteren Intendanten der Moskauer Kaiserlichen Theater, hatte Tschaikowski sehr inspiriert. Doch erst die Version, die Petipa und Iwanow achtzehn Jahre später am Mariinsky-Theater in St. Petersburg herausbrachten, gab dem wirkungsvollen Szenarium eine stringente Form. Petipa blickte damals auf eine fast fünfzigjährige Erfahrung in der Inszenierung grosser Ballettproduktionen zurück und verfügte über ein unerschöpfliches Wissen. Er wusste genau, wie ein Ballett auszusehen hatte, damit es beim anspruchsvollen Publikum ankam. Er kannte jeden Kniff und verschaffte Tschaikowskis Partitur jene Bühnenwirkung, die der Moskauer Schwanensee hatte vermissen lassen.
Seit der Uraufführung der 1895er-Schwanensee-Fassung von Marius Petipa und Lew Iwanow sind mehr als 120 Jahre vergangen, in denen viele Choreografen-Generationen ihren Schwanensee auf die Bühnen gebracht und unseren Blick auf dieses Ballett verändert haben. Ist das, was wir heute mit Schwanensee verbinden, eine Fälschung?
Das kommt auf den Blickwinkel an. Ich bin nicht sicher, ob Tschaikowski über die bereits 1895 ausgeführten Veränderungen an seiner Partitur so glücklich wäre. Wichtige Bestandteile wie etwa die Sturmmusik aus dem letzten Akt sind gestrichen, und es wurden zahlreiche Umstellungen vorgenommen. Er würde Schwanensee wahrscheinlich nicht als sein eigenes Werk wiedererkennen. Und auch Petipa wäre entsetzt über die Veränderungen, die seine Choreografie aushalten musste und muss. Mit Blick auf das Original kann man also durchaus von Verfälschungen sprechen. Andererseits sehe ich aber auch die Notwendigkeit, dass sich jede Generation mit dem Stoff auseinandersetzt und sich ihren eigenen Schwanensee erschafft. Das ist ein stetiger Prozess. Ich selbst allerdings plane keinen weiteren Schwanensee. Anstatt an einer weiteren Fassung herumzulaborieren, choreografiere ich dann doch lieber ein eigenes Ballett. Und ausserdem gibt es ja noch das komplette notierte Mariinsky-Repertoire der Petipa-Ära. Über zwanzig Ballette, von denen die meisten noch auf ihre Rekonstruktion warten.
Wie verläuft dieser Prozess, bei dem die Originalchoreografie von immer neuen Choreografie-Schichten überlagert wird?
Im Ballett ist das tägliche Realität. Wir kreieren Schritte, und schon am nächsten Tag kommt ein Tänzer mit einer Vorstellung, die nur ein bisschen anders ist. Der Ballettmeister oder Choreograf sagt dann vielleicht: «Prima. Lass es uns so machen.» Man kann sich ausrechnen, wie oft das in hundert Jahren passiert sein mag. Doch auch die Welt, die uns umgibt, verändert sich ständig: Lebenstempo, Mode, Reisen... Für das Ballett war es unmöglich, sich zu konservieren. Doch mit Hilfe der Stepanow-Notation, in der die grossen Ballette des Petersburger Repertoires aufgeschrieben sind, haben wir die Möglichkeit, diese Werke wiederauferstehen zu lassen.
«Marius Petipa wusste genau, wie ein wirkungsvolles Ballett auszusehen hatte»
Anstatt also den hundertsten Schwanensee in der Tradition von Marius Petipa und Lew Iwanow zu choreografieren, gehen Sie hier in Zürich auf die 1895 in St. Petersburg uraufgeführte Originalversion der beiden zurück. Wo verläuft die Grenze zwischen Original und Tradition?
Die Schritte sind anders! Ich kann nicht versprechen, dass dieser Zürcher Schwanensee wirklich genauso aussehen wird wie damals, und vielleicht kann man es nicht einmal Rekonstruktion nennen, da wir ja weder das Bühnenbild noch die Kostüme rekonstruieren und auch nicht über die gleiche Anzahl von Tänzern verfügen. Wir können uns nicht in eine Zeitmaschine setzen, um uns in die Körper und Köpfe von damals hinein zu katapultieren. Natürlich kenne ich die widersprüchlichen Auffassungen zu Rekonstruktionen, aber für mich ist eines ganz klar: Ich bin selbst Choreograf und fände es schlimm, wenn jemand meine Choreografie so einfach verändert. Der soll doch bitte seine eigenen Sachen machen! Wenn ich Schwanensee inszenieren soll, möchte ich Petipas Intention, die in den Notationen verankert ist, so nahe wie möglich kommen. Diese Notation ist oft nicht vollständig. An diesen Stellen muss man dann Dinge erfinden und imaginieren, was Petipa an dieser Stelle gemacht haben könnte. Es ist also im Grunde die Sicht eines Choreografen von heute auf das Kunstwerk von Petipa. Die Tradition hingegen beinhaltet auch all jene Veränderungen, die sich über die Jahre in eine Choreografie eingeschlichen haben. Man hat vielleicht einen Tänzer, der grandios in Pirouetten ist, und schon verändert man eine Phrase, um für ihn mehr Pirouetten in der gleichen Zeit unterzubringen. So kommt eins zum anderen. Alle originalen Intentionen, die Logik, die Verbindung zur Musik etc. verschwindet. In der Tradition spiegelt sich die jahrzehntelange, kollektive Arbeit hunderter Tänzer und Choreografen auf der ganzen Welt. Wie Schwanensee 1895 genau ausgesehen hat, wissen wir nicht. Ich kann versichern, dass ich alles verfügbare Archivmaterial gesichtet habe. Mit Hilfe der Notation und weiterer Quellen haben wir die Möglichkeit, uns dem Original so dicht wie möglich anzunähern und eine Vorstellung davon zu gewinnen, wie die Originalchoreografie ausgesehen hat.
Ihre Rekonstruktion basiert auf den Stepanow-Notationen des Balletts, die nach einer abenteuerlichen Odyssee durch Europa heute in der Sergejew- Collection der Harvard University in den USA aufbewahrt werden. Was ist das Wesen dieser Notation?
Vladimir Stepanow hat dieses System der Bewegungsnotation, mit dem man Einzelheiten einer Choreografie chiffrieren und protokollieren konnte, 1892 veröffentlicht. In ein erweitertes, musikalisches Notensystem wurden die Positionen von Kopf, Torso, Armen und Beinen sowie deren rhythmische Bewegungen eingetragen. Von einer angesehenen Kommission erhielt Stepanow den Auftrag, das gesamte Repertoire des Kaiserlichen Balletts in dieser Notation aufzuschreiben. Petipa selbst war übrigens skeptisch und meinte, er interessiere sich nicht für Skelette. Nach Stepanows frühem Tod haben Alexander Gorsky und Nikolai Sergejew diese Dokumentation fortgesetzt. Über einen Zeitraum von mehr als 20 Jahren haben sie notiert: oft unter Zeitdruck, manchmal doppelt. Gelegentlich wurden ganze Szenen ausgelassen, oder es gibt nur einen Bühnengrundriss, auf dem lediglich die Struktur der Formationen abgebildet ist. Eine Riesenarbeit! Die Pantomime wird beschrieben, aber es gibt keine Angaben dazu, wie Gesten und Mimik ausgeführt werden. Hier muss man auf Gestik zurückgreifen, wie sie etwa im Repertoire dänischer und britischer Tänzer überlebt hat. Die Beinbewegungen sind jedoch fast durchweg genau aufgezeichnet, so dass man hier fast durchgängig von einer Rekonstruktion sprechen kann. Die Notation vermerkt, ob ein Bein gebeugt oder gestreckt ist, wie hoch es gehoben wird, in welche Richtung und in welchem Winkel. Allerdings wird keine Ballettterminologie verwendet, sondern man beschränkt sich auf rein mechanische Angaben. Der Oberkörper ist selten notiert, so dass man hier auf traditionelle Versionen zurückgreifen oder sich von anderen Quellen wie alten Fotografien und Filmen inspirieren lassen muss.
Warum haben Sie sich so tiefschürfend mit den Notationen auseinandergesetzt?
All die traditionellen Schwanensee-Versionen, die sich da grossspurig auf Petipa und Iwanow beriefen, haben mir einfach nicht gefallen. Ich hatte meine Zweifel, ob Petipa das wirklich so gemacht hätte. Beim Vertiefen in die Notationen erhärtete sich mein Verdacht, dass hier in grossem Stil geändert worden war. In Russland, aber auch in Westeuropa und Amerika, haben die Ballettmeister und Choreografen es nach der Oktoberrevolution regelrecht als eine Notwendigkeit angesehen, Veränderungen vorzunehmen. Man fühlte sich geradezu dazu verpflichtet, die alte Ballettsprache etwas aufzufrischen. Die gesellschaftlichen Verhältnisse hatten sich verändert – und mit ihnen natürlich auch das Publikum. Neue Ideen waren gefragt. Alles, was nach Anmut, Manierismus oder irgendwie kompliziert aussah, erschien verdächtig. Gefragt waren Athletik, Einfachheit, Attacke. Man wollte sich selbst als Schöpfer etablieren und benutzte aber weiterhin auch Teile des alten Materials. Verurteilen sollte man das nicht. Auch Petipa fuhr jeden Sommer nach Paris, um sich neue Ballette anzuschauen und schrieb sich die interessantesten Sachen auf. Damals wie heute ist das gängige Praxis: Irgendwo sieht man einen Schritt, der einem gefällt und übernimmt ihn. Ich wollte jedoch verstehen, wie der wirkliche Petipa aussieht, was seine Sprache und seinen Stil ausmacht.
«Wenigstens ein Theater auf der Welt sollte Petipas Originalschritte zeigen!»
Wie verfahren Sie mit «Leerstellen» der Choreografie?
Ich versuche, sie im Sinne Petipas aufzufüllen und greife dafür auf alle nur denkbaren zur Verfügung stehenden Quellen, also auch auf Fotos, Zeichnungen und Filmaufnahmen, zurück. Je mehr man sich in die Notationen vergräbt, desto besser versteht man ihre Logik und entwickelt ein Verständnis dafür, wie das Original ausgesehen haben mag. Man entwickelt einen Sinn für die Koordination des Ganzen. Rekonstruktion bedeutet für mich kein sklavisches Nachbuchstabieren, sondern in die Haut des Choreografen schlüpfen, seine Entscheidungen zu verstehen und die eigenen in seinem Geiste zu treffen. In Petipas Choreografien aus den 1890er-Jahren – damals war er bereits über 70 – merkt man deutlich, wie sich sein Stil von der Französischen Schule wegbewegt und sich zunehmend italianisiert. Er reflektiert die neue Virtuosität der italienischen Tänzer, die an den Kaiserlichen Theatern gastierten.
Wie viel Alexei Ratmansky wird man in diesem Zürcher Schwanensee erleben können?
Ich hoffe, dass man meine Sensitivität und meinen Geschmack eher im Coaching der Tänzer als in der Choreografie spürt. Ich gehe auf grösstmögliche Distanz. Trotzdem würde die Rekonstruktion eines anderen Choreografen, der ebenfalls mit der Notation arbeitet, wahrscheinlich anders aussehen als meine. In Amerika habe ich kürzlich Dornröschen rekonstruiert. Bereits 1999 hat Sergej Vikharev das am Mariinsky-Theater versucht. Wir sind zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen. Die Notation mit einer musikalischen Partitur zu vergleichen, wo die Interpretationsergebnisse zumindest ähnlich klingen, wäre zu einfach.
Was hat Sie aus der Perspektive des 21. Jahrhunderts bei der Beschäftigung mit den Notationen am meisten überrascht?
Was dort an Schritten und Bewegungen notiert ist, erscheint mir einfach sinnvoll. Sie haben mich in dem Gefühl bestärkt, dass diesen notierten Versionen der Vorrang vor den tradierten Fassungen zu geben ist. Ihr Tempo ist viel schneller und wesentlich dichter an den originalen Tschaikowski-Tempi. Die sowjetischen Versionen sind wahnsinnig langsam. Die Überbetonung der virtuosen Elemente drängt die Partitur förmlich ins Abseits. Wenn russische Compagnien Schwanensee tanzen, sieht das meist sehr langsam aus, und es klingt auch so. Britische Versionen sind schneller, am schnellsten ist das New York City Ballet. Die Amerikaner sind am dichtesten dran an den originalen Tschaikowski-Tempi, allerdings mit Schritten von Balanchine.
Bei Ihrer Schwanensee-Rekonstruktion wird man sich also vermutlich verwundert die Augen reiben und die Ohren spitzen?
Die Schwäne sehen anders aus. Sie haben noch keine Federn in den Haaren, sondern offene, fallende Haare. Die Tutus ähneln mehr einem Rock als einem seitlich abstehenden Tutu. Es gibt viele Männer in den Schwanenszenen: nicht nur den Prinzen, sondern auch seine Freunde und Jäger. Wenn sich Siegfried mit der Schwanenkönigin unterhält, ist sein bester Freund Benno dabei. Die Szene gipfelt in einem Pas de trois. Zwischen Siegfried und Benno scheint eine besondere Beziehung zu bestehen. Ich glaube nicht, dass es sich um einen «Fehler» handelt. Die Schwanenszene war ja von Iwanow schon ein Jahr zuvor für die Gedenkvorstellung zu Tschaikowskis Tod choreografiert worden und ist dann in den Kontext der kompletten Fassung integriert worden. Wenn Petipa und Iwanow das hätten ändern wollen, hätten sie es sicher getan. Es gibt Schwanenkinder und schwarze Schwäne, die in westlichen Produktionen eigentlich nie zu sehen sind. Sie werden nur am Mariinsky- und am Bolschoi-Theater eingesetzt. Was die Choreografie angeht, gibt es natürlich gravierende Unterschiede. Die Corps de ballet-Szenen sind wunderschön und komplex in ihren Formationen. Petipa benutzte weniger Schritte als heute üblich, seine Choreografie wirkt nie überchoreografiert. Deshalb konnte sie schneller getanzt werden. Es gibt weniger überstreckte Körperlinien. Es dominieren Rundungen und Kurven. Gebeugte Knie. Siegfried und seinen Freunden begegnen die Schwäne in Mädchengestalt. Man hat zwar eine Ahnung, dass sie keine «normalen» Mädchen sind, aber die typischen, von Agrippina Waganova verfeinerten Arme als Zeichen für die Schwanenflügel sind verschwunden. Und auch der Schwarze Schwan (Odile), der wie Odette von der gleichen Ballerina getanzt wird, ist eher mädchen- als schwanenhaft. Ich hoffe, dass sich mit dieser Vermenschlichung auch insgesamt der Eindruck grösserer Anmut einstellt.
Wir haben viel über Petipa gesprochen, aber der Anteil von Lew Iwanow ist natürlich ebenso präsent.
Sie werden lachen, aber ich bin tatsächlich mit ihm verwandt. Der Bruder meiner Grossmutter war der Mann seiner Enkelin. Iwanow war eine enigmatische Figur. Er war zunächst Solist des Mariinsky-Balletts und wurde später zweiter Ballettmeister, der gelegentlich auch choreografieren durfte, wohlgemerkt in Petipas Schatten. Insofern war es für ihn eine einmalige Chance war, dass er – bedingt durch eine Erkrankung Petipas – die weissen Akte in Schwanensee choreografieren durfte. Es sind Wunderwerke, die ihrer Zeit voraus sind. Im Vergleich zu Petipa ist Iwanows Choreografie noch weicher und poetischer.
Wie erleben Sie die Zusammenarbeit mit dem Ballett Zürich?
Ich arbeite zum ersten Mal in Zürich. Jede Compagnie hat ihre eigene Mentalität, auf die man sich einstellen muss. Da wir auf das Schwanensee-Original zurückgehen, sind viele effektvolle Momente aus späteren Fassungen nicht mehr vorhanden. Bei den Tänzern kann das gelegentlich das Gefühl auslösen, nicht genug von sich zeigen zu können. Ich versuche sie dahingehend zu inspirieren, auch in dem reduzierten Vokabular Energie und Schönheit zu entdecken. Es braucht Zeit, diese Balletttechnik aus einer versunkenen Zeit zu erlernen und an sie zu glauben. Ich ermutige die Tänzer, das Ganze als neuen choreografischen Stil anzunehmen, den sie sich genau wie die Stile eines Douglas Lee oder Paul Lightfoot erschliessen.
Welche Rolle spielt die Pantomime?
Die Pantomime in den Handlungsballetten hatte eine viel grössere Bedeutung als heute. Früher wurde ein Tänzer nicht nur danach beurteilt, wie gut er tanzte, sondern auch sein Spiel wurde einer eingehenden Bewertung unterzogen. «She is beautiful, but she can’t mime» war ein vernichtendes Urteil. In Schwanensee gibt es viele Gesprächssituationen. In der letzten Szene sagt Odette immer wieder, dass sie sterben wird. Sie gestikuliert. Und auch, als der Prinz sie fragt, warum sie ein Schwan sei, erzählt sie ihm mit Gesten ihre Geschichte. Die Tänzer müssen mit der Pantomimik genauso vertraut sein wie mit dem Schrittmaterial.
Welche Einsichten vermitteln Sie den Tänzern über ihre Rollenpsychologie?
Meistens ist diese Psychologie bereits in den Schritten verankert. Man muss nichts dazu addieren, weil das Schrittmaterial an sich schon über eine grosse Expressivität verfügt. Es geht nicht um die Zurschaustellung von Anmut, gutem Training oder schönen Linien. Zu einem wesentlichen Teil liegt das Drama auch in der Musik. Wir müssen einen Weg finden, die dramatische Qualität der Musik und der Geschichte durch den Körper auszudrücken.
Welche Konsequenzen hat die Rekonstruktion für Ihren Bühnen- und Kostümbildner Jérôme Kaplan?
Da wir hier keine wissenschaftliche Arbeit machen, hat er in seiner Interpretation eine gewisse Freiheit. Er rekonstruiert weder die Bühne noch die Kostüme von 1895 und wird also kein Museumsstück auf die Bühne bringen. Die einzigen Vorgaben sind die Handlungsschauplätze und die Bühnengrundrisse aus den Notationen. Aber natürlich lässt er sich von den Originalkostümen inspirieren.
Was erhoffen Sie sich von Ihrem Zürcher Schwanensee?
Natürlich haben auch die traditionellen und neuen Versionen von Schwanensee ihre Qualitäten und ihre Existenzberechtigung. Doch wenigstens ein Theater auf der Welt sollte doch bitte die Originalschritte von Petipa zeigen. Deshalb freue ich mich sehr auf diesen Schwanensee! Ich bin mir im Klaren darüber, dass so eine Rekonstruktion in Russland ein Riesendrama wäre und bin gespannt, wie das Publikum in Zürich und an der koproduzierenden Mailänder Scala reagieren wird. Die Texttreue darf nicht den Eindruck erwecken, dass wir einem historischen Experiment beiwohnen. Herauskommen muss interessantes, lebendiges Theater!
Das Gespräch führte Michael Küster
Dieser Beitrag ist erschienen im MAG 36, Januar 2016.
Das MAG können Sie hier abonnieren.