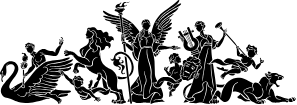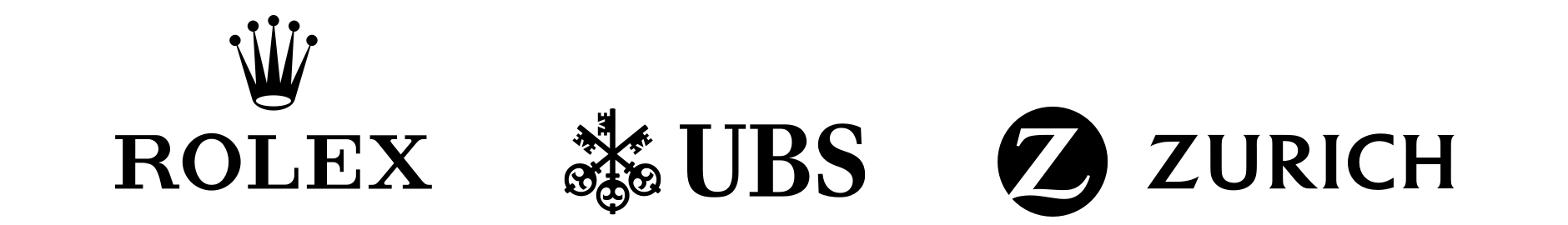Intendant Andreas Homoki besteht auf Differenzierung in der Debatte um Wokeness, Diversität und kulturelle Aneignung. Ein Gespräch über das emanzipatorische Anliegen von Kunst, Shitstorms, erlaubte Eingriffe in die Werke und Empathie für Ausgegrenzte
Es geht darum, die Freiheit der Kunst zu verteidigen
Andreas, wir spielen an den Opernhäusern ein Repertoire, das zu grossen Teilen aus Werken des 18. und 19. Jahrhunderts besteht. In ihnen geht die Darstellung von Randgruppen oder die Stellung der Frau von ganz anderen gesellschaftlichen Übereinkünften aus als heute. Ist es ein Problem, wenn die Opern in unserer Gegenwart erklingen, die viel sensibler auf Diskriminierung und versteckten Rassismus reagiert?
Das finde ich nicht. Man muss dabei bedenken, welche Opern sich bis heute im Repertoire gehalten haben und warum. Die meisten Opern, die im 18. und 19. Jahrhundert geschrieben wurden, kennen und spielen wir ja gar nicht mehr, weil sie zu sehr an die Zeit ihrer Entstehung gebunden und dem Gesellschaftsbild unserer Zeit nicht mehr vermittelbar sind. Die Aufführungsgeschichte wirkt über die Jahrhunderte hinweg wie ein starker Filter. Und ich wage die These, dass den Opern, die uns heute noch etwas zu sagen haben, letztlich immer ein emanzipatorisches Anliegen innewohnt. In der Oper geht es – wie in der griechischen Tragödie – immer um den Konflikt zwischen einer oder einem Einzelnen und der Gemeinschaft. Und jeder Konflikt ist getrieben von einer emanzipatorischen Energie – gegen Unterdrückung, für Freiheit und Selbstbestimmung. Daraus erwächst eine überzeitliche Kraft, die wir heute noch spüren. Natürlich haben die meisten Opern des 19. Jahrhunderts eine männlich dominierte Gesellschaft als Hintergrund, weil das damals halt so war. Aber ich finde, dass die wirklich guten Autoren mit ihren Werken über die zeitgebundenen Hierarchien hinausweisen. Deshalb sind die Frauen immer wieder Utopieträgerinnen in den Opern. Sie scheitern, aber der Appell, dass sich die Verhältnisse ändern müssen, bleibt über ihren Tod hinaus bestehen. Der Humanitätsanspruch ist ganz eng mit der emotionalen Kunstform Oper verbunden. Und wirklich grosse Kunst ist frei von Ressentiments.
«Die sozialen Medien erzeugen Meinungsdruck, der nicht auf Argumenten basiert, sondern moralisch urteilt»
Gegenbeispiele diskutieren wir in dieser Debatte, von Mozart bis Richard Strauss.
Opern existieren nur, wenn wir sie aufführen, und das heisst, wir interpretieren sie und untersuchen sie auf ihre Relevanz für unsere Zeit. Die Partituren haben eine grosse Offenheit in den Darstellungsmöglichkeiten. Nicht selten ist unser Bild von einem Stück durch die Rezeptionsgeschichte verzerrt, die unter Umständen diskriminierend und rassistisch geprägt ist. Aber dann guckt man sich das Stück genau an und stellt fest: So ist es eigentlich gar nicht. Es ist viel universeller, und ich muss es gar nicht so machen, wie es immer scheint.
Diskriminierendes findet sich also eher in einer schlechten Aufführungstradition als in den Stücken selbst?
Was heisst schlecht? Es sind Aufführungstraditionen, die an ihre jeweilige Zeit gebunden sind. Ich würde das gar nicht werten. Sie sind für heute einfach nicht mehr interessant.
Wer ist zuständig für diese Überprüfung, die letztlich verhindern soll, dass sich Diskriminierung fortsetzt?
Das ist eine künstlerische Aufgabe. Die liegt vor allem in den Händen der Regie.
Wie stark darf man in Werke eingreifen, um sie für unsere Zeit akzeptabel zu machen?
Rein rechtlich kann ich als Regisseur mit den Stücken machen, was ich will, wenn das Urheberrecht abgelaufen ist. Aber natürlich gehen wir auf der Basis eines grossen Verantwortungsgefühls gegenüber den Partituren mit den Werken um. Das gängigste Mittel eines Eingriffs ist, etwas zu streichen, von dem man meint, dass es irgendwie stört oder zu lang dauert. Als Regisseur sollte ich mich aber erstmal allen Sperrigkeiten des Stücks stellen und sagen: Es gibt nichts, was sich szenisch nicht lösen lässt. Übermässiges Streichen kann ein Indiz dafür sein, dass es sich die Regie zu leicht gemacht hat. Die Widerstände, die eine Oper bei der szenischen Umsetzung bietet, sind produktiv. Man muss sich ihnen stellen, dann kommt unter Umständen etwas viel Interessanteres dabei raus.
Darf man unzeitgemässe Librettotexte umschreiben?
Was heisst dürfen? Das ist eine Frage, die durch künstlerische Überlegungen beantwortet werden muss. Hier und da einen Satz verantwortungsvoll umzuschreiben, finde ich nicht dramatisch. Das ist für uns am Haus kein Sakrileg.
Wie stark sind Werke grundsätzlich interpretierbar? Kann man Aussagen in ihr Gegenteil verkehren?
Bei einem wirklich guten Stück wird das schwierig. Die Stücke haben ihren eigenen Wahrheitskern, der unhintergehbar ist. Wenn eine interpretatorische Annahme gegen das Stück läuft, funktioniert es theatralisch nicht. Das Publikum merkt das sofort und ist zu Recht verärgert. Der musikalisch-szenische Inhalt einer Oper ist wie ein Strom. Dem musst du folgen. Du kannst nicht dagegen anschwimmen.
Machst du als Intendant Vorgaben? Sagst etwa einem Team, das Die Entführung aus dem Serail machen soll, dass du Osmin nicht als Karikatur eines wütenden Muslims auf der Bühne sehen willst?
Für den künstlerischen Suchvorgang darf es keine inhaltliche Einschränkung vonseiten der Theaterleitung geben. Vielleicht ergibt sich ja eine Inszenierungsmöglichkeit, die klug mit so einer Klischeefigur umgeht und sie umwertet. Ich würde nie eine pauschale Ansage machen im Sinne von: Komm mir ja nicht mit diesem oder jenem. Als Intendant muss ich den Künstlerinnen und Künstlern vertrauen, die ich mit einer Neuproduktion beauftrage.
Du verteidigst die Freiheit der Kunst gegen Ansinnen von aussen wie Forderungen nach Wokeness oder Political Correctness.
Genau. Darum geht es.
Wie würdest du das Klima beschreiben, in dem im Moment Themen wie Wokeness diskutiert werden?
Ich empfinde es als ein sehr ungutes Klima. Der Diskurs wird stark von den sozialen Medien geprägt, die keine demokratisch legitimierte Macht haben, aber Meinungsdruck erzeugen, der nicht auf Argumenten basiert, sondern moralisch und ideologisch urteilt. Die anonymen Shitstorms werden dann oft von den seriösen Medien als Meinungsrealität präsentiert. Die liberalen gesellschaftlichen Kräfte tun sich schwer, dagegen zu halten, aus Angst, etwas vermeintlich Falsches zu sagen. Und plötzlich steht die populistische Frage im Raum, ob wir Winnetou abschaffen müssen. Meine Sorge ist, dass sich unsere liberale, demokratische Gesellschaftsordnung durch solche Partikularkämpfe schwächt und dekonstruiert und dadurch anfällig für totalitäre Interessen wird.
Was folgt daraus für die Arbeit an einem Opernhaus?
Das Reflexhafte an der Oberfläche ist nicht die Sache der Kunst. Wir müssen auf einer differenzierten Betrachtung und gedanklicher Tiefe bestehen.
Wie gehst du mit der Gefahr um, einen Shitstorm abzukriegen?
Ich versuche, diesen Druck nicht an mich ranzulassen. Ich muss Dinge aussprechen dürfen, von denen ich der Meinung bin, dass sie richtig sind. Und das tue ich. Natürlich müssen wir in einer Kunstinstitution unsere Sprache und unser Handeln immer kritisch überprüfen. Wir leben in einer konkreten Zeit mit ihren jeweiligen Themen und Konflikten, und wir lernen nie aus. Aber wir müssen auch darüber nachdenken dürfen, ob die tagesaktuelle Debatte gerade so bedeutend ist, dass wir dafür in die Freiheit der Kunst eingreifen. Kunst darf auch mal unbequem dem Zeitgeist widersprechen. Ich finde in dieser Hinsicht übrigens auch die Debatte über sogenannte kulturelle Aneignung problematisch. Das Wesen des Theaters besteht nun einmal in der Verwandlung. In der Oper geht es darum, dass sich jemand durch Kostüm, Maske, Szene in eine Figur verwandelt, dass der Chor die Gestalt des Volkes in einem fernen oder nahen Land annimmt. In letzter Konsequenz würde die Diskussion um kulturelle Aneignung zu einer Auflösung aller Möglichkeiten führen, Verwandlung auf der Bühne zu zeigen. Das ist eine Sackgasse.
In der Diskussion geht es um stereotype Darstellungen, um rassistische Klischeebilder anderer Kulturen.
Meine Zürcher Inszenierung von Land des Lächelns spielt in einem China in Anführungsstrichen. Wir haben für diese Operette ein superkünstliches Musical-China entworfen, wie ein Zitat aus einem alten Revuefilm, und dagegen haben wir die typischen Europäer gestellt. Es ist ein bewusstes Spiel mit dem Stereotypen, das Zitathafte wird kenntlich gemacht.
Es gibt in Opern aber auch einen kolonialistischen Zugriff, der aus einer Position westlicher Überlegenheit agiert, das Fremde als etwas Bedrohliches ausstellt oder sich nur oberflächlich eines exotischen Kolorits bedienen will. Da wird es problematisch. Das kann man beispielsweise in Puccinis Turandot diskutieren.
In Turandot ist das Asiatische absolut verzichtbar. Man kann die Oper ohne einen einzigen Chinesen inszenieren. Ich habe es selbst so gemacht, die Oper funktioniert trotzdem. Bei Madama Butterfly hingegen wird der kulturelle Konflikt zwischen Ost und West, zwischen Japan und den USA, im Stück thematisiert, und zwar explizit antiimperialistisch. Um ihn darzustellen, braucht man die Gegensätze zwischen einem traditionellen Japan und den imperialistischen Vereinigten Staaten.
Eine Theater-Direktion kann an den Punkt kommen, an dem sie abwägen muss zwischen der Kunstfreiheit und der Verantwortung gegenüber Minderheiten. Wo sind die Grenzen?
Ich darf Menschen in der Kunst nicht verletzen oder Verletzung ignorieren. Da endet die Freiheit der Kunst. In den Niederlanden gibt es seit Jahren eine Debatte um den Zwarte Piet, den Helfer des Nikolaus, der Kinder, die nicht brav sind, bestraft wie bei uns Knecht Ruprecht. Die Figur hat zwar eine lange Tradition und ist irgendwie folkloristisch in der Gesellschaft verankert, hat aber einen rassistischen und kolonialistischen Hintergrund – und ist negativ besetzt. Wenn ich mir vorstelle, ich bin Vater eines schwarzen Kindes, und mein Kind ist mit dieser Figur konfrontiert, dann muss ich sagen: Das geht nicht. Das ist eine rassistische Verletzung. Die Empathie für ausgegrenzte oder vergessene Figuren ist übrigens auch beim Inszenieren ein wesentlicher Aspekt. Ich muss alle Figuren im Blick haben und sie zu ihrem Recht kommen lassen. Man kann schwache Regiearbeiten daran erkennen, dass in ihnen Randfiguren auf der Bühne einfach übergangen werden. Man muss versuchen, sie zu fokussieren, sich ihrer Situation und ihrem Fühlen annehmen und herausarbeiten, woran sie zugrunde gehen, gerade wenn sie nicht im Zentrum der Handlung stehen.
Wir werden in der kommenden Spielzeit Michael Endes Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer als Familienoper spielen, in der die Hauptfigur ein Schwarzer Junge ist. Die Geschichte gehört inzwischen auch zu den kritisch hinterfragten Stoffen der Kinderliteratur. Siehst du da ein Problem?
Überhaupt nicht. Das ist ein wunderbarer Stoff für Kinder, aber auch für Erwachsene. Es ist eine liebevolle, bewusst inklusive Geschichte, die aus einer antirassistischen Haltung heraus geschrieben ist. Und das werden wir so auch auf der Bühne zeigen.
Wie wird Jim Knopf besetzt sein?
Wegen der vielen Vorstellungen brauchen wir zwei Sängerinnen für diese Partie. Beide haben dunkle Hautfarbe.
Bist du dafür Opern, so zu besetzen, dass sich die Identität der Darstellenden mit der Figur deckt oder plädierst für sogenannte Colourblindness bei Besetzungen?
Die Frage kann man nicht pauschal beantworten. Was heisst das? Reden wir von der Hautfarbe oder auch von der kulturellen Sozialisation? Was veranschaulicht wiederum eine «farbenblinde» Besetzung? Wenn ich eine Familie auf der Bühne erzählen will, finde ich es schon okay, wenn sich Familienähnlichkeit auch im Aussehen der Darstellenden abbildet und nicht alle Mitglieder aus verschiedenen Erdteilen kommen. Andererseits: Als ich Bellinis I puritani gemacht habe, war es überhaupt nicht wichtig, dass wir mit Pretty Yende eine Südafrikanerin als Hauptfigur hatten und ihr Vater ein chinesischer Sänger war. Es kommt immer auf die jeweiligen theatralischen Annahmen und die Ästhetik der Aufführung an.
Wir würdest du Verdis Otello besetzen?
Otello hat sich in den letzten Jahren zu einem solchen Problem entwickelt, dass Opernhäuser bereits geplante Neuproduktionen kurzfristig wieder absagen. Das ist sehr schade, denn das Stück ist eine leidenschaftliche Anklage gegen rassistische Ausgrenzung. Die muss man zeigen können. Müsste ich die Oper selbst inszenieren, würde ich vielleicht versuchen, sie total divers zu besetzen mit einer asiatischen Desdemona, einem schwarzen Jago, einem südamerikanischen Otello – und im Vorspiel schminken sich alle weiss, nur einer nicht. Ich sage das, um klarzumachen, dass man in eine theatralische Situation kommen muss.
«Die Diskussionen um kulturelle Aneignung führen in eine Sackgasse, denn Theater ist immer Verwandlung»
In Otello mit Schminke arbeiten? Das könnte schwierig werden.
Warum? Schminke ist ein legitimes theatralisches Mittel. Ursprünglich richtete sich Kritik an Blackfacing völlig zu Recht gegen eine rassistische Verunglimpfung schwarzer Menschen. Wer wollte das nicht unterstützen! Leider haben die Diskussionen inzwischen aber einen solchen Hang zu künstlicher Aufgeregtheit und Oberflächlichkeit, dass sie dem emanzipatorischen Anliegen eher schaden.
Strebt das Opernhaus Zürich grundsätzlich eine grössere Diversität bei Besetzungen an?
Wir versuchen, die bestmöglichen Künstlerinnen und Künstler für das jeweilige Stück zu bekommen. Wir brauchen internationale Klasse und sind absolut offen für Diversität. Wir müssen um der theatralischen Glaubwürdigkeit willen aber auch typgerecht besetzen. Sonst verlieren die Opern ihre Relevanz. Zuallererst muss es natürlich immer um künstlerische Qualität gehen.
Ist Quotierung ein Instrument, um Vielfalt im Opernhaus zu fördern?
Das wollen wir nicht. Das finde ich unkünstlerisch und auch menschlich unfair. Wenn man andere Kriterien als rein inhaltliche zulässt, kann das sehr gefährlich werden. Es könnte ja auch jemand auf die Idee kommen, bestimmte Menschen nicht mehr haben zu wollen. Kunst muss ihren eigenen Kriterien folgen, und Diversität muss sich aus dem Angebot ergeben. Folglich ist ein wichtiger Punkt Diversität bei der Förderung junger Talente. Ich bin stolz darauf, dass wir in unserem Internationalen Opernstudio Sängerinnen und Sänger aus allen Teilen der Welt fördern.
Das Gespräch führte Claus Spahn.
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 98, Februar 2023.
Das MAG können Sie hier abonnieren.