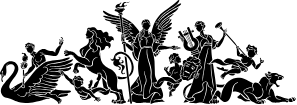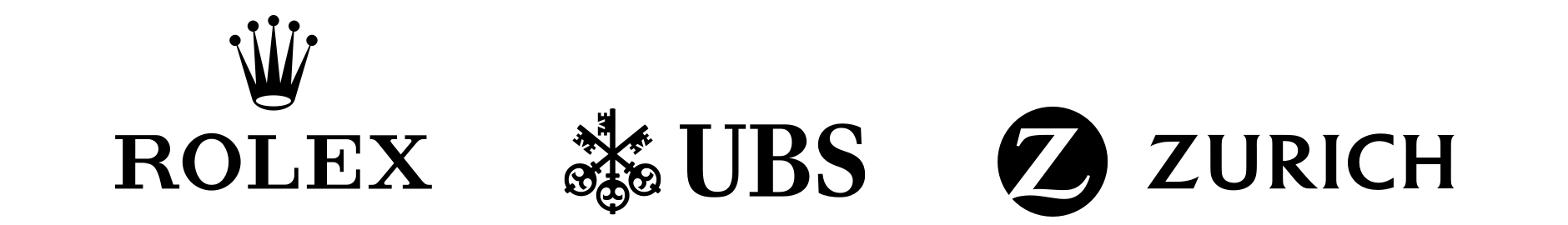Die Opéra de Paris hat vor zwei Jahren eine grossangelegte Studie zur Diversität an ihrem Haus in Auftrag gegeben und die Ergebnisse in Strukturveränderungen und neuen Kommunikationsformen umgesetzt. Wir haben bei der Diversitätsbeauftragten Myriam Mazouzi nachgefragt, was sich an der grössten Bühne Frankreichs verändert hat
Wir haben mit
Traditionen gebrochen
Frau Mazouzi, an der Pariser Oper wurde 2021 ein «Rapport sur la Diversité» veröffentlicht, eine umfangreiche Studie über die strukturelle und künstlerische Vielfalt an Ihrem Haus. Wie ist es dazu gekommen?
Dem «Rapport» ist ein Manifest vorausgegangen, das im Zuge der Black Lives Matter-Bewegung und nach den Protesten, die die Ermordung von George Floyd in den USA ausgelöst hatten, bei der Leitung der Pariser Oper eingereicht wurde. Dieses Manifest wurde von nicht-weissen Künstlerinnen und Künstlern aus unserer Ballettcompagnie und aus dem Chor verfasst. Es ist sehr sachlich und respektvoll formuliert, ohne Polemik und ohne anklagenden Ton. Die Unterzeichnenden forderten, dass über Diskriminierungen aufgrund von Herkunft oder Hautfarbe nicht mehr geschwiegen wird, und dass gewisse damit zusammenhängende Traditionen abgeschafft werden.
«Im Corps de Ballet war es bisher üblich, dass sich die Tänzerinnen und Tänzer weiss puderten»
Können Sie ein konkretes Beispiel nennen, das die Betroffenen in ihrem Manifest nennen?
Im Corps de Ballet der Pariser Oper war es bisher bei einem bestimmten Repertoire üblich, dass sich die Tänzerinnen und Tänzer die Haut weiss puderten. Diese Praktik hängt ursprünglich mit der spezifisch französischen Tradition des romantischen Balletts zusammen, den sogenannten «Ballets blancs» wie beispielsweise La Sylphide oder Giselle. Es ging darum, das Weiss der Kostüme auch auf den Körper auszuweiten, also um ein ästhetisches Ideal, um Uniformierung. Im 21. Jahrhundert, in dem Tänzerinnen und Tänzer mit verschiedenen Hautfarben zum Corps de Ballet gehören, ist diese Tradition aber nicht mehr praktikabel. Für Menschen mit schwarzer Hautfarbe hat es nicht den gleichen symbolischen Wert, sich weiss zu pudern, wie für solche mit weisser Hautfarbe. Die Unterzeichnenden im Manifest wünschen sich deshalb, dass man in Zukunft auf individuelle Hautfarben Rücksicht nimmt und auch entsprechende kosmetische Produkte zur Verfügung stellt. Solche konkreten Forderungen haben das Projekt rund um die Diversität ins Rollen gebracht.
Der Direktor der Pariser Oper Alexander Neef hat daraufhin den «Rapport» in Auftrag gegeben. Wer hat diese Studie erarbeitet, und welche Auswirkungen hat sie heute auf den Betrieb?
Wir haben Constance Rivière damit beauftragt, die im Bereich der Politik und Kultur tätig ist, und den Historiker Pap Ndiaye, der sich bereits öffentlich zu Fragen der Diversität geäussert hatte und ein Experte für die Diskriminierungsgesetze in den USA ist. Pap Ndiaye ist unterdessen Bildungsminister von Frankreich geworden, aber das ist natürlich ein Zufall. Der «Rapport sur la Diversité» ist sehr umfangreich und macht viele Vorschläge. In der Praxis verfolgen wir heute vorrangig einige zentrale Punkte: Als erstes ging es darum, eine «Référente Diversité» zu bestimmen, eine zentrale Verantwortliche und eine Anlaufstelle. Zurzeit habe ich diese Position inne, allerdings nur für drei Jahre. Mir ist es wichtig, dass dieser Posten beweglich bleibt und in drei Jahren an jemand anderen übergeht.
Welche Entscheidungen haben Sie in dieser Position bisher getroffen?
Als eine der ersten Massahmen habe ich ein Gremium geschaffen, das sich in regelmässigen Abständen trifft und drängende Fragen berät. Dazu gehören der Direktor Alexander Neef, die Leitung der Personalabteilung, der Direktor des Balletts, die Leiterin der Ballettschule, künstlerische Vertreter aus dem Ballett und dem Chor sowie verschiedene Intellektuelle, die uns beratend unterstützen wie die Historikerin Sylvie Chalaye, die das Buch Race et Théâtre geschrieben hat, oder die Schriftstellerin Tania de Montaigne, die sich literarisch ebenfalls mit Fragen der Diskriminierung auseinandergesetzt hat. In diesen Runden diskutieren wir jeweils über grundsätzliche strukturelle, aber auch über inhaltliche künstlerische Fragen.
Zum Beispiel?
In einer Runde haben wir uns der Nussknacker-Choreografie von Rudolf Nurejew gewidmet. In diesem Stück gibt es bekanntlich Charaktertänze, die verschiedenen Nationen zugeordnet sind: den Chinesischen, Russischen, Arabischen und Spanischen Tanz. Wir haben das Video der Choreografie in die Runde geschickt und anschliessend darüber diskutiert. Zunächst ging es um die Kontextualisierung: Das Mädchen Klara schläft ein und träumt, dass ihre Spielzeuge lebendig werden. Die Charaktertänze gehören in den Rahmen dieser Traumebene, bilden also keine Realität, sondern eine Welt der Fantasie und Karikatur ab. Als nächstes behandelten wir die Frage, ob diese Karikaturen in irgendeiner Weise diskriminierend sind. Schliesslich haben wir entschieden, im Chinesischen Tanz Änderungen an den Kostümen vorzunehmen und eine pantomimische Aktion im Arabischen Tanz zu ändern: Dort gab es eine Szene, in der Frauen mit der Hand zu essen gegeben wurde. Dieses offensichtliche Klischee erachteten wir als problematisch.
Diskutieren Sie in diesen Runden auch über Opern und Textbücher, die als problematisch gelten?
Ja, wir haben beispielsweise eine Runde mit der iranisch-französischen Regisseurin Mariame Clément gemacht. Sie hatte beim Glyndebourne Festival Rossinis Il turco in Italia inszeniert und in unserer Runde erzählt, wie sie mit den diskriminierenden Passagen im Libretto umgegangen ist. Es gibt in ihrer Inszenierung beispielsweise einen Moment, in dem alle als Türken verkleidet sind, nach dem Motto: Jeder ist jemandes «Türke». Ausserdem macht sie den Dichter Prosdocimo zu einer zentralen Figur, die die problematischen Stellen des Librettos in der Inszenierung kommentiert. Das Libretto selbst wurde aber nicht geändert. Mir ist es wichtig, dass die Inszenierung zeigt, dass wir heute nicht mehr der gleichen Meinung sind wie im 19. Jahrhundert, dass sie sich zum Text verhält oder sich davon distanziert.
Gibt es andere Fälle, in denen man den Text ändern sollte? Ich habe beispielsweise gerade eine Zauberflöte in Strasbourg gesehen, in der Monostatos nicht mehr singt: «Weil ein Schwarzer hässlich ist», sondern «Weil mein Wesen hässlich ist». Was halten Sie davon?
Ich bin dagegen. Wir haben solch eine Änderung einmal gemacht, aber aus einem ganz anderen Grund: In Brittens The Rape of Lucretia gibt es eine Stelle im Textbuch, in der Tarquinius sagt: «Patricia lay naked with a negro.» Weil der Sänger aber selber Schwarz war, hat diese Aussage in unserem Kontext keinen Sinn mehr ergeben. Deshalb haben wir den Text umgeschrieben. Wenn der Sänger nicht Schwarz gewesen wäre, hätten wir aber auch das Wort «negro» nicht geändert. Ich finde, dass man die Texte nicht ändern sollte, weil Kunstwerke auch immer die Denkweise ihrer jeweiligen Epoche reflektieren. The Rape of Lucretia ist ein Stoff, der auf Shakespeare und die Antike zurückgeht...
Sie sind also dagegen, «die Geschichte zu revidieren», wie Caroline Fourest, eine prominente feministische Kritikerin linker Identitätspolitik, das ausdrückt?
Ja, dass sich die weissen europäischen Männer im 19. Jahrhundert als überlegen betrachtet haben und einen ganz spezifischen Blick auf andere Kulturen hatten, widerspiegelt sich in vielen Opern und Balletten aus dieser Zeit. Ich finde, wir sollten uns lieber kritisch mit diesen Werken auseinandersetzen, anstatt sie vom Spielplan zu nehmen. Bei besonders heiklen Themen müssen wir natürlich umsichtig sein, aber nicht pauschal. Das Wort «nègre» ist im Französischen nicht grundsätzlich abwertend gemeint. Mit dem Begriff «Négritude» hat der aus Martinique stammende Schriftsteller Aimé Césaire beispielsweise eine bedeutende literarisch-philosophische Strömung mitbegründet, die sich kritisch mit dem kolonialistischen Denken auseinandersetzt und für Schwarze Selbstbestimmung eintritt. Als Kulturinstitutionen haben wir die Aufgabe, differenziert über diese Sachverhalte nachzudenken und dem Publikum in Programmheften oder Einführungsveranstaltungen Verständnishilfen zu geben.
Im Manifest, das an der Pariser Oper eingereicht wurde, steht auch die Forderung, in Zukunft auf das Black- und Yellowfacing zu verzichten.
Damit haben wir aufgehört. Das ist keine Diskussion mehr. Das Blackfacing hängt mit einer langen Tradition in den USA, aber auch in Europa zusammen, die ganz eindeutig diskriminierend ist. In den Minstrel-Shows hat man sich auf herablassende Weise über Schwarze Menschen lustig gemacht. Dass das Blackfacing komplett abgeschafft gehört, darüber sind sich alle einig.
Das Thema Yellowfacing wird seltener angesprochen. Warum ist das so?
Ich glaube, das liegt daran, dass das Thema weniger stark aufgearbeitet ist, und dass die asiatischen Gesellschaften sich bisher weniger dagegen mobilisiert haben. Aber auch damit müssen wir, beispielsweise bei Madama Butterfly, um ein prominentes Opernbeispiel zu nennen, unbedingt aufhören. Eng verbunden mit diesem Thema besteht heute noch immer das Problem – zumindest in Frankreich –, dass asiatische und Schwarze Sängerinnen und Sänger besonders Mühe haben, für bestimmte Rollen überhaupt engagiert zu werden. Dieses Problem wird sich nicht lösen, wenn die Rollen, die aufgrund ethnischer Merkmale ihnen «gehören», noch immer von Weissen gesungen werden.
Sind Sie also der Meinung, dass beispielsweise Verdis Aida, laut Libretto eine Äthiopierin, vorrangig von einer Schwarzen Sängerin gesungen werden sollte?
Ja, heute ist das wichtig, weil Schwarze Sängerinnen und Sänger aufgrund von Äusserlichkeiten noch immer einen erschwerten Zugang zu vielen Rollen im Repertoire haben. Diejenigen, die ihnen ganz klar «gewidmet» sind, wie beispielsweise Verdis Aida, sollten deshalb ausschliesslich an sie vergeben werden. Ich hoffe aber, dass wir dieses Problem durch Veränderungen in der Ausbildung und im Casting in einigen Jahren nicht mehr haben werden, und dass der Zugang zum Arbeitsmarkt für Schwarze und asiatische Sängerinnen und Sänger vereinfacht wird. Und in diesem Fall fände ich es dann richtig, wenn Schwarze auch weisse Partien singen und umgekehrt.
«Wir sollten uns kritisch mit den Werken auseinandersetzen, anstatt sie vom Spielplan zu nehmen»
Sie sind neben Ihrer drei Jahre dauernden Funktion als Diversitätsbeauftragte hauptberuflich Direktorin der Académie, die sich der Nachwuchsförderung widmet. Inwiefern können die Ausbildung und die Talentsuche zu mehr Diversität an der Pariser Oper beitragen?
Wir müssen junge Talente so fördern, dass sie zu Vorbildern werden. In unserer Ballettcompagnie hat sich da beispielsweise schon viel getan. Ein Tänzer wie Guillaume Diop, der senegalesisch-französische Eltern hat, wird in ein paar Jahren ein Star sein. Damit Tänzer wie er überhaupt zu uns kommen, ist es wichtig, das Aufnahmeverfahren und die Jurys zu steuern – und hier spielt die Académie eine grosse Rolle. Ich habe beispielsweise ein Projekt in Französisch-Guyana initiiert, weil wir uns gegenüber dieser ehemaligen Kolonie öffnen wollen. Es gibt dort ein Konservatorium und zahlreiche Ballettschulen, die bisher nicht mit uns in Verbindung standen. Ich habe dann gemerkt, dass die New Yorker Alvin Ailey-Schule dort bereits vor Jahren Tänzerinnen und Tänzer gecastet hat, die heute zu ihren Stars gehören. Aber zu uns nach Paris hat sich niemand gewagt, obwohl Französisch-Guyana politisch mit uns verbunden ist. Diese Barriere wollen wir abbauen und haben in Cayenne und anderen Städten Rezitals und Ballett-Workshops organisiert, die begeistert aufgenommen wurden.
Mit der Forderung nach mehr Diversität geht manchmal die Angst einher, dass Quoten mehr Gewicht kriegen könnten als die Qualität. Wie sehen Sie das?
Die Frage nach Quoten ist an ganz bestimmten Stellen wichtig, vor allem bei den Jurys, die das Auswahlverfahren steuern. Es geht natürlich nicht, dass nur Männer in einer Jury sitzen, das ist klar. Es ist also einerseits wichtig, Talente verschiedenster Herkunft zu finden und einzuladen, und andererseits eine möglichst diverse Jury zu haben, die diesen Kandidatinnen und Kandidaten auch gleiche Chancen einräumt.
Sie sind täglich mit Problemen des Theateralltags konfrontiert. Wo gibt es, Ihrer Meinung nach, noch am meisten zu tun?
Eines der Hauptprobleme ist die Angst. Alle haben Angst vor diesem Thema, und viele wagen im Alltag nicht, darüber zu sprechen. Wir sollten diese Ängste abbauen, denn sie bringen uns nicht weiter.
Das Gespräch führte Fabio Dietsche.
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 98, Februar 2023.
Das MAG können Sie hier abonnieren.