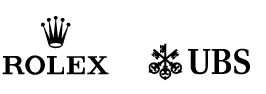Wir sind noch nicht vom institutionellen Rassismus befreit
Die Mezzosopranistin Katia Ledoux, deren Karriere in Zürich am Interntionalen Opernstudio begann, kämpft für Vielfalt und gegen Diskriminierung an Opernhäusern. Ein Gespräch über Erfahrungen und Hoffnungen einer Schwarzen Sängerin
Katia, ich möchte mit dir über Diskriminierung und Vielfalt in der Welt der Oper sprechen. Du gehörst zu einer jungen, kritischen Generation von Sängerinnen, der diese Themen wichtig sind. Fangen wir bei den Werken an: Wie diskriminierend empfindest du die Stoffe, die dir im Opernalltag begegnen?
Ich hatte bis jetzt das Glück, nicht so vielen dieser Stoffe in meinem direkten Opernalltag zu begegnen, weil ich mich sehr viel im Barock und im zeitgenössischen Repertoire bewege. Es ist aber nicht möglich, zu ignorieren, dass es sehr viele problematische Werke gibt, die in den Statistiken der am meisten gespielten Opern ganz oben stehen.
Zum Beispiel Mozarts Zauberflöte.
Genau. Auch Werke wie Madama Butterfly oder Turandot sind schwierig. Aber an der Zauberflöte kommt man nicht vorbei. Wenn ich das Libretto lese, könnte ich mich stundenlang darüber ärgern.
«Wenn ich das Libretto der «Zauberflöte» lese, könnte ich mich stundenlang aufregen.»
Was regt dich auf?
Sexismus, Rassismus, Heteronormativität… Pamina wird entführt, weil Sarastro meint, die Königin der Nacht könnte sie als Frau alleine nicht erziehen. Monostatos singt eine «lustige» Arie darüber, dass er die schöne weisse Frau vergewaltigen möchte, «weil ein Schwarzer hässlich ist» und sie ihn freiwillig nie lieben würde. Währenddessen sitzen im Publikum kleine Schwarze Kinder oder Kinder von Familien, die vielleicht nicht traditionell aussehen. Was macht es mit einem Kind, so etwas zu sehen und zu hören? Da braucht es schon extrem viel Regiearbeit, um diesen Stoff so zu bearbeiten, dass er etwa auch als Kinderoper aufführbar ist.
Wie gehst du damit um? Weigerst du dich, in der Zauberflöte aufzutreten?
Ich habe meine Bachelorarbeit über die Zauberflöte geschrieben und hatte eigentlich mit mir selbst den Deal gemacht, nie in ihr zu singen. Diesen Deal habe ich aber schon zweimal gebrochen. Einmal in Zürich in einer sehr klugen Inszenierung von Tatjana Gürbaca und einmal in Wien in einer wunderschönen Inszenierung von Mason Henry. Als junge Sängerin ist es nicht so einfach zu sagen: «Nein, das singe ich nicht!»
Wie gehen die Opernhäuser heute deiner Meinung nach mit den heiklen Stoffen um?
Ich habe den Eindruck, dass viele Bühnen inzwischen sensibel reagieren, da hat sich in den letzten Jahren einiges getan. Ich selbst mache die Erfahrung, dass ich meine Vorbehalte thematisieren und mit der Regie oder der Dramaturgie darüber reden kann, das wird auch ernst genommen. Bisher habe ich immer einen Weg gefunden, nicht bei einer Produktion dabei sein zu müssen, bei der ich mich unwohl fühle, weil sie gegen meine tiefsten Überzeugungen verstösst. Vielleicht liegt es daran, dass ich mich traue, die Themen offensiv anzusprechen. Aber vielleicht hatte ich auch einfach nur Glück. Natürlich gibt es Regisseure, die für Einwände nicht offen sind und nie etwas ändern würden. Dann bleibt einem wahrscheinlich keine andere Möglichkeit, als aus dem Projekt auszusteigen.
Plädierst du dafür, die Zauberflöte nicht mehr zu spielen?
Ich sage nicht, dass man die Oper aus dem Repertoire verbannen soll. Die Musik ist wahnsinnig schön, das ist ja klar. Ich verstehe, dass man den Menschen diese Oper nicht wegnehmen kann. Aber ich finde, man kann sie heute nur noch in einer Inszenierung spielen, die sich der Problematik bewusst ist und Lösungen dafür findet. Andererseits: Was wäre so schlimm daran, wenn sie mal ein paar Spielzeiten nicht gespielt würde? Es gibt so viele andere spannende Werke mit wunderschöner Musik. Es wird manchmal gesagt: Die Oper droht auszusterben, wenn sie kein neues Publikum erreicht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man neue Zugänge vor allem mit Stücken ausserhalb des traditionellen Repertoires schafft, indem man Geschichten erzählt, in denen sich Menschen wiederfinden, die bisher noch kein Opernhaus betreten haben. Vor eineinhalb Jahren habe ich am Amsterdamer Opernhaus in einer neuen Oper mitgewirkt, wo genau das gelungen ist. Sie heisst How Anansi Freed the Stories of the World, stammt vom südafrikanischen Komponisten Neo Muyanga und erzählt eine Geschichte, die ich aus karibischen Märchen meiner Kindheit kannte. Ich wusste nicht, dass fast jede Schwarze Community auf der Welt eine eigene Version des Spinnenwesens Anansi kennt. Als die Opernplakate in der Stadt hingen, hat die Community in Amsterdam gesagt: Oh, das ist eine Geschichte, die wir kennen, da gehen wir hin. Und das Theater war voll mit Menschen, die sonst kaum in der Oper zu sehen sind.
Wo stehen die Opernhäuser, was das Thema Diversität angeht?
Ich habe das Gefühl, es tut sich gerade viel, und ich hoffe, dass das nicht nur meine subjektive Wahrnehmung ist. Es gab enorme Schritte in den vergangenen zwei Jahren, die auch manche Formen von Diskriminierung unmöglich gemacht haben. So wurde 2020 in den USA die Black Opera Alliance gegründet. Sie hat sehr viel in Bewegung gebracht. Bisher war die Antwort auf die Frage, warum an den Opernhäusern fast nur Weisse singen: Es gibt halt keine guten Schwarzen Sänger:innen. Jetzt legt die Opera Alliance sofort eine sehr, sehr lange Liste mit sehr, sehr guten Schwarzen Opernschaffenden auf den Tisch und sagt: Es gibt sie. Man muss sie einfach nur engagieren. Die alten Argumente sind nicht länger haltbar.
Haben der Mord an George Floyd 2020 und die Black Lives Matter-Bewegung der Entwicklung einen Schub verliehen?
Die #BlackLivesMatter-Bewegung wurde ja eigentlich schon 2013 gegründet, nach dem Freispruch des Mörders von Trayvon Martin. In den letzten Jahren hat die Bewegung immer wieder Proteste organisiert, um auf die Tötung unschuldiger Schwarzer Menschen von Polizeibeamten, auf racial profiling und Polizeigewalt aufmerksam zu machen. Die bekanntesten Fälle, die durch #BlackLivesMatter ins Bewusstsein gerückt wurden, sind die Morde an Eric Garner, Tamir Rice, Philando Castile, Aiyana Jones, Walter Scott, Breonna Taylor oder Michael Brown, dessen Ermordung die riesigen Proteste in Ferguson herbeigeführt hat. Aber die vollständige Liste ist viel, viel länger und voll extremt schrecklicher Geschichten. Von dem Mord an George Floyd gab es ein Video, und das hat die ganze Welt wachgerüttelt. Der Rassismus gegenüber Schwarzen wird seitdem in einer neuen Dimension diskutiert. Die Black Opera Alliance ist 2020 gegründet worden. Zunächst war sie eher als Community zur Vernetzung und gegenseitigen Unterstützung gedacht. Daraus hat sich aber schnell eine starke politische Kraft entwickelt, die den Impuls in die Opernhäuser trägt: Lasst uns die Situation endlich verändern! Und in den USA hat sich seit der Gründung tatsächlich sehr viel bewegt. Die Alliance fordert gerechte Repräsentanz in den Häusern. Genau so viel Prozent wie Schwarze Leute in einer Stadt leben, sollen auch an der Oper arbeiten. Die Alliance zeigte auf, dass die Diskrepanz in sehr vielen Fällen unglaublich gross war.
«Die Ausgrenzung von Sängerinnen und Sängern aus dem asiatischen Raum macht mich wütend»
Wie sieht es in Europa aus?
Auch da tut sich einiges. Immer mehr Opernhäuser bemühen sich immer mehr, die Diversität der Städte, in der sie sich befinden, auch in ihrem Ensemble und in der Gestaltung der Spielpläne zu spiegeln. Es ist noch lang nicht perfekt, und wir sind als Gesellschaft noch nicht von institutionellem Rassismus oder Microaggressions geheilt, aber wir sind auf einem guten Weg.
In Zürich sagt man gerne: Hier leben ja gar nicht so viele Schwarze Menschen.
Meine Lebensrealität in Zürich war eine andere. Es kommt halt darauf an, wo man hingeht. Ich habe eine ausgeprägte Schwarze Community erlebt mit Restaurants, Afro-Shops, Friseurläden, die von manchen Kreisen aber vielleicht nicht wahrgenommen wird.
Sind die Opernhäuser nach wie vor Kulturinstitute der weissen Oberklasse?
Im Moment schon noch. Es ist schwer, da reinzukommen. Für alle jungen Sängerinnen und Sänger ist das auch eine materielle Frage. Ohne die finanzielle Unterstützung meiner Eltern hätte ich keine Karriere starten können. Um zu Vorsingen zu kommen, musst du viel reisen, hast Unterkunftskosten. Als Freischaffender am Beginn deiner Laufbahn verdienst du nicht viel und hast hohe Kosten. Alleine dadurch ist der Zugang zur Welt der Oper sehr limitiert. Ich kenne viele junge Kolleginnen und Kollegen mit wunderschönen Stimmen, die es nicht auf die Bühne schaffen, weil ihnen die materielle Grundlage fehlt. Auch die Visumsbarriere ist ein grosses Problem. Du kannst nicht einfach ohne festen Job, nur mit der Hoffnung auf schöne Engagements in einem Land ein Visum beantragen. Nehmen wir Südafrika als Beispiel: Das Land hat in den letzten Jahren unglaublich viele tolle Stimmen hervorgebracht, die auch in Wettbewerben erfolgreich waren. Und wo sind sie jetzt alle? Die meisten kommen nicht durch, weil ihnen das Geld und eine Aufenthaltserlaubnis fehlen. Deshalb kommt die Oper nicht weg von Milieus der weissen wohlhabenden Menschen. Das gilt genauso für Sängerinnen und Sänger aus dem asiatischen Raum. Ihre Ausgrenzung macht mich so wütend. Wir hatten viele Leute aus Korea an der Musikhochschule, supergute Stimmen, teilweise zum Niederknien schön. Aber die kriegen anschliessend einfach keinen Job und müssen wieder zurück nach Hause. Gleichzeitig ist der Kontinent bei der Besetzung asiatischer Rollen mit asiatischen Künstlerinnen und Künstlern so gut wie nicht existent. Man sieht kaum je eine asiatische Turandot. Das passt für mich nicht zusammen.
Nervt es dich eigentlich, dass du immer wieder zu den Themen Diskriminierung und Rassismus Stellung beziehen sollst? Die Regisseurin Tatjana Gürbaca hat mal polemisch gesagt: Sie werde andauernd zu ihrer Position als Frau befragt, während die Männer gleich ihre tollen Inszenierungskonzepte vorstellen dürfen. Empfindest du das als Schwarze Frau ähnlich?
Ja und nein. Was mich nervt, ist, wenn die Leute von mir nur spektakuläre Opfergeschichten hören wollen: Was ist das Schlimmste, das dir widerfahren ist? Es ist etwas anderes, wenn man das Gespräch mit mir als Expertin für diese Themen sucht, weil ich dann nicht in einer Opferrolle angesprochen werde. Ich bin überhaupt kein Opfer. Ich habe wahnsinnig Glück gehabt in meinem Leben. Das ist der Grund, warum ich so offen reden kann und es auch möchte. Ich hatte enorme Privilegien. Ganz viele problematische Situationen sind mir erspart geblieben.
Welche Privilegien meinst du?
Ich bin zwar Schwarz – ich schreibe das mit grossem, politisch selbstbewussten S –, aber sehr hellhäutig. Dadurch habe ich viel weniger Diskriminierung erfahren. Auch deshalb liegt mir daran, über die Themen zu sprechen, weil ich es kann. In meiner Ausbildung wurde mir oft gesagt, dass ich nicht öffentlich über Sachen wie Feminismus, Queerness und Rassismus sprechen soll, sonst könnte ich meine Karriere vergessen. Das würde den Leuten Angst machen, man würde mich nicht besetzen usw. Musst du dich wirklich als Schwarz definieren? Mach es dir doch nicht unnötig schwer. Aber es wäre für mich völlig absurd gewesen, das nicht zu tun. In meiner Gesangausbildung in Wien hat man mir geraten, ich solle auf jeden Fall für mich behalten, dass ich mit einer Frau zusammen bin. Das käme im Betrieb überhaupt nicht gut an. Jetzt stehe ich auf den Premierenempfängen, schaue mich um und frage mich: Gibt es hier eigentlich auch jemand, der nicht gay ist? Ich habe Glück in Opernhäusern zu arbeiten, in denen ich so sein kann wie ich bin und das machen zu können, was ich liebe. Aber genau deshalb ist es wichtig, dass ich mich für die Menschen einsetze, die das Privileg nicht haben, und so versuche, den Weg für die nächsten Generationen einfacher zu machen.
Wir müssen auch über Blackfacing reden, also das Schwarzschminken weisser Menschen auf der Bühne. Welche Erwartungen hast du bei diesem Thema an die Opernhäuser?
Blackfacing geht gar nicht. Es ist diskriminierend und verletzend.
«Ich habe noch keinen einleuchtenden Grund gehört, warum Blackfacing sinnvoll wäre»
Du erwartest, dass die Theaterleitungen das respektieren?
Wenn sie weiter daran festhalten, sind sie einfach nur zu faul und zu unkreativ, anders damit umzugehen. Ich habe bisher noch keinen einleuchtenden Grund gehört, warum Blackfacing sinnvoll oder wichtig wäre.
Es gab im vergangenen Sommer in der Arena di Verona einen prominenten Fall von Blackfacing, der hohe Wellen geschlagen hat. Anna Netrebko ist als Aida schwarz geschminkt aufgetreten, und die Sopranistin Angel Blue hat ihren Auftritt als Traviata daraufhin abgesagt, weil sie nicht mit einem Veranstalter identifiziert werden wollte, der Blackfacing zulässt.
Da konnte man erleben, wieviel Aggression das Thema auslöst. Angel Blue hat die sehr schwierige Entscheidung getroffen, ihre Traumrolle abzugeben, um Haltung zu zeigen, und hat dafür so üble Hasskommentare auf den sozialen Medien bekommen, dass sie ihre Kanäle abschalten musste. Währenddessen wirbt der Veranstalter immer noch stolz mit Blackface-Bildern auf der Webseite.
Die Veranstalter haben entschuldigend argumentiert, es handele sich um eine alte Inszenierung von Luchino Visconti, die könne man nicht ändern.
Es hätte andere Möglichkeiten gegeben, damit umzugehen. 2019 hat die Sopranistin Tamara Wilson sich zum Beispiel geweigert, für die Produktion angemalt zu werden, und damit ein starkes Zeichen gesetzt. Drei Jahre später sieht man, dass die Veranstalter nichts gelernt haben. Der Fall wurde geradezu zu einer Glorifizierung von Blackfacing. Vielleicht ist die Welt der Oper eben doch noch nicht so tolerant, wie sie sich gerne gibt. Das Problem ist nicht die Kunstform, sondern es sind die Institutionen, in denen sie stattfindet, die Strukturen, in die sie eingebettet ist. Ich gebe nochmal ein anderes Beispiel: Genderfluidität ist ja im Moment ein grosses Thema. Es wird begrüsst, dass die Oper dafür so offen ist – Frauen treten in Männerrollen auf, Männer singen Frauenpartien. Aber an jedem Opernhaus gibt es eine superstrikte Geschlechtertrennung, was Garderoben, Kostüm und Maske angeht. Ich habe an der Stuttgarter Staatsoper in einer Produktion von Rusalka gesungen, in der Crossdressing konzeptionell eine grosse Rolle spielt, und es war sehr kompliziert zu organisieren, wer für wen die Kostüme macht. Ist für ein Drag Queen-Kostüm jetzt die Herren- oder die Damenschneiderei zuständig? Sind wir wirklich noch an dem Punkt? Es ist nur ein kleines Beispiel, aber es zeigt, wie eingefahren die Strukturen sind. Das sitzt eben noch tief in vielen Köpfen: Ich erinnere mich an eine Produktion, bei der in der Premierenansprache ein Mann dafür gelobt wurde, dass er einen anderen Mann auf der Bühne geküsst hat. Wow, wie mutig. Ich habe als queere Frau noch nie Lob dafür bekommen, wenn ich einen Mann auf der Bühne geküsst habe.
Als du in Amsterdam warst, hast du im Rahmen eines Black Achievement Month sieben Tipps an dein jüngeres Ich gepostet. Einer lautete, man soll immer vorbereitet sein, sich selbst schminken zu können. Was hast du damit gemeint?
Es gibt an Opernhäusern immer noch Maskenabteilungen, die sich mit nichtweisser Haut und nichtweissen Haaren nicht auskennen. Ich habe schon in der Maske gesessen und Kommentare gehört wie: Uff, das wird jetzt kompliziert. Für diese Hautfarbe haben wir nichts Passendes. Da müssen wir improvisieren und etwas zusammenmixen. Soll ich mich dafür entschuldigen? Ich sage dann: Es ist nicht mein Job, aber ich schlage folgendes vor. Ich habe immer mein eigenes Makeup dabei für den Fall der Fälle.
Dein Tipp Nummer eins lautete: Stay angry. Stay kind.
Ja, denn es gibt so viel auf der Welt, das mich wütend macht, gerade in der Oper. Ich könnte mich stundenlang darüber aufregen, weil ich die Oper so unendlich liebe und es nicht akzeptieren möchte, dass es Menschen schwer gemacht wird, in ihr zu arbeiten oder als Publikum einen Zugang zu finden.
Mir fällt in unserem Gespräch allerdings eher der zweite Teil deines Tipps auf – die Freundlichkeit, die gute Laune, die positive Art, mit der du über Themen sprichst, die dich bedrücken.
Weil ich auch denke, dass man mit Wut alleine nicht viel bewegen kann. Wut ist wichtig. Wer nicht wütend ist, hat nicht aufgepasst, weigert sich, den Schmerz anderer zu sehen, oder fühlt einfach nicht mit. Aber mit Wut alleine kann man nur zerstören. Nicht aufbauen. Ich liebe die Oper. Ich möchte eine Welt erschaffen, in der Oper besser, zugänglicher, schöner, leistbarer, offener für alle ist. Deshalb: Stay angry, but stay kind.
Das Gespräch führte Claus Spahn.
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 98, Februar 2023.
Das MAG können Sie hier abonnieren.