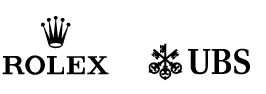Die Zauberflöte
Grosse Oper in zwei Aufzügen von Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Libretto von Emanuel Schikaneder
In deutscher Sprache mit deutscher und englischer Übertitelung. Dauer 3 Std. 10 Min. inkl. Pause nach ca. 1 Std. 10 Min. Werkeinführung jeweils 45 Min. vor Vorstellungsbeginn.
Gut zu wissen
Essay
Mozart liebte es, die Vorstellungen der Zauberflöte zu besuchen, die nach der Uraufführung am 30. September 1791 Abend für Abend ein grosser Erfolg waren. In einem Brief an seine Frau Constanze schildert er einen solchen Besuch: Er hatte an diesem Abend einen Gast bei sich, der mit der Aufführung nichts anfangen konnte und «alles belachte». Das ging Mozart so auf die Nerven, dass er ihn während der Vorstellung sitzen liess, ihn wütend einen «Papageno» hiess und die Loge wechselte. Dort überkam ihn plötzlich die Lust, das Glockenspiel selbst zu spielen. Er lief hinter die Bühne, setzte sich ans Instrument und spielte ein Arpeggio an einer völlig unpassenden Stelle. Emanuel Schikaneder, der als Papageno auf der Bühne stand, erschrak, schaute in die Kulissen und erkannte Mozart. Als das Glockenspiel dann tatsächlich erklingen sollte, machte Mozart sich den Spass, zu schweigen und brachte Schikaneder dadurch völlig aus dem Konzept. «Nun hielt er und wollte gar nicht mehr weiter. Ich erriet seinen Gedanken und machte wieder einen Akkord. Dann schlug er auf das Glockenspiel und sagte ‹Halts Maul›, alles lachte dann. Ich glaube, dass viele durch diesen Spass das erstemal erfuhren, dass er das Instrument nicht selber schlägt.»
So ging es also zu in den Vorstellungen der Zauberflöte: Mozart erlaubt es sich, seinem Freund und Partner Schikaneder bei offenem Vorhang einen Streich zu spielen. Schikaneder verwandelte die Not in eine schlagfertige Pointe, und alle klopften sich die Schenkel vor Lachen. Diese Briefstelle ist eine der sprechendsten aus Mozarts Korrespondenz im letzten Lebensjahr, weil sie etwas von der Theaterlust und dem Spass erkennen lässt, der rund um die Entstehung der Zauberflöte geherrscht haben muss. Man kann erahnen, wie die beiden Theaterkumpane sich hinterher noch in der Garderobe über die Aktion kaputtgelacht haben – der Kindskopf Mozart, dem ein spontaner Spass mehr bedeutete als die korrekte Wiedergabe seiner eigenen Noten, und das Rampenschwein Schikaneder, das in solchen ungeplanten Momenten zu extragrosser Form auflief.
Die Briefstelle erzählt von Mozarts unbändiger Lust, aus den Bahnen des Vorhersehbaren auszubrechen. Die überkam ihn zeit seines Lebens wie ein Juckreiz, dem er nachgeben musste. Dann gestattete er sich auch mal einen bewusst falschen Einsatz. Wenn Mozart seinem eigenen Notentext eine Nase dreht und gewissermassen Fünf gerade lässt, heisst das freilich nicht, dass er es mit seiner Kunst nicht so genau nimmt. Ihn interessierte, um im Bild zu bleiben, die Fünf als ungerade Zahl sehr wohl, aber mehr noch reizt ihn die Vorstellung von der Fünf als einer geraden Zahl. Beim Alogischen hakte seine Intelligenz erst richtig ein. Er bezog Inspiration aus albernen Verdrehungen, trieb ein absurd komisches und zugleich tiefgründiges Spiel mit Falsifizierungen, überraschenden Abbrüchen, Auslassungen und skurrilen Wendungen. Das gilt für seine Art, Briefe zu verfassen, aber auch für seine Musik: Der geniale Geist hatte eben Strukturen viel zu schnell durchschaut, als dass er Befriedigung darin gefunden hätte, ihnen brav zu folgen. Mozart wurde, gerade weil er im Formenkanon seiner Zeit fest verankert war, zum wilden Denker, störte bewusst die Gleichgewichte, wo das Ebenmass nahelag, experimentierte mit Asymmetrien und schroffen Kontrasten, ertüftelte Täuschungsmanöver, liebte das Vielgestaltige bei hoher Schnelligkeit und Gleichzeitigkeit der Verlaufsformen und schuf sich eigene Balancen jenseits des Vorgegebenen.
Was für seinen Umgang mit den Stilkonventionen seiner Zeit gilt, trifft auch auf sein Verhältnis zu Hierarchien zu. Mozart fügte sich selbstverständlich übergeordneter Autorität, aber in ihm rumorte doch die Lust, sie zu hinterfragen und subversiv zu untergraben. Er hatte – wie Figaro in seiner «Se vuol ballare»-Arie – Lust, ein Tänzchen mit dem Grafen zu wagen. Natürlich nicht frei von Ambivalenzen, wie sie der Mozart-Biograf Maynard Solomon beschreibt: «Weil in ihm Spannungen zwischen Zorn und Zurückhaltung, Überheblichkeit und Unterwürfigkeit, Zerstörungstrieb und Schicklichkeit herrschen, bedienen sich Mozarts radikale Eingebungen keiner Gemeinplätze und schlagen keine voraussagbaren Bahnen ein. Da er ganz wie sein Vater skeptisch und vorsichtig gegenüber schnellen Lösungen und im Zweifel über die Beweggründe der Menschen ist, schloss er sich nicht kritiklos charismatischen politischen Führern und deren Reformprogrammen an. Seine radikalen Triebkräfte gerieten unter den Einfluss des Spieltriebs, der Kunst, der Sprache, des Rituals, die dadurch die Kanäle für den Ausdruck seines Altruismus und die Ventile für seine Wut öffneten.»
In der Zeit, in der Mozart an der Zauberflöte arbeitete (es waren bekanntlich seine letzten Lebensmonate), kam noch etwas anderes hinzu – Rastlosigkeit, gepaart mit extremen Stimmungsschwankungen, über die die Briefe im Sommer 1791 an seine in Baden zur Kur weilende Constanze Auskunft geben. Nach Monaten, in denen sein Schaffensdrang ins Stocken geraten war, kehrte seine Kreativität im Frühling 1791 mit starker Energie zurück. Er schrieb die Zauberflöte, La clemenza di Tito, das Klarinettenkonzert und vieles mehr. Er hatte extrem viel zu tun und arbeitete unter enormem Zeitdruck. In den Briefen erkennt man eine Persönlichkeit, die immer auf dem Sprung ist, unstet, getrieben, hin und her gerissen zwischen anspruchsvollen künstlerischen Aufgaben und einfachen Lebensgenüssen, kreativer Beflügelung und Einsamkeit. Er vermisst seine Frau, erträgt es nicht, alleine essen zu müssen, läuft ins Wirtshaus, wo sein Lieblingskellner «Don Primus» mit den leckeren «Carbonadeln» um die Ecke biegt, schreibt in dieser Zeit aber auch seinen berühmten Depressionsbrief: «…ich kann dir meine Empfindung nicht erklären, es ist eine gewisse Leere, die mir halt wehe tut, ein gewisses Sehnen, welches nie befriedigt wird, folglich nie aufhört, immer fortdauert, ja von Tag zu Tag wächst...»
Man muss das alles vor Augen haben, wenn man über die Zauberflöte nachdenkt. Sie ist das heissgeliebte, alle beglückende Herzenswerk im Opernrepertoire und zugleich ein Rätselstück, über dessen Werkgestalt und höhere Botschaft von jeher nicht minder heiss diskutiert wird. Denn ihre Handlung ist durchzogen von Ungereimtheiten, Brüchen und Widersprüchen. Die beginnen damit, dass die Königin der Nacht als gute, gerechte Herrscherin und Sarastro als böser Tyrann in das Stück eingeführt werden und die Vorzeichen sich im zweiten Teil umzudrehen scheinen, Sarastro als vermeintlich tugendhafter Weisheitslehrer herrscht und die Königin als tempelschänderische, zum Mord anstiftende Unheilsfigur vernichtet wird.
Sie setzen sich fort in der Verschränkung der Formen: Die Zauberflöte ist zugleich naives Märchen und bretterknarrendes Wiener Vorstadt-Theater, symbolschweres Mysterienritual und leichtes Singspiel. Und sie enden in den vielen Details der Handlung, die nicht zusammen passen wollen: Tamino ist im ersten Akt noch als Retter Paminas im Auftrag der Königin unterwegs und wird im zweiten Akt von einer Szene zur nächsten zum folgsamen Prüfling im Bann des Sarastro-Kreises. Die drei Knaben werden Tamino von der Königin der Nacht als Schutzengel und Sendboten mit auf den Weg gegeben, mahnen aber später Sarastros Tugenden an. Der Herrscher propagiert Toleranz und Grossmut, ist aber Sklavenhalter, verhängt Prügelstrafen und redet schlecht über Frauen. Die drei Damen scheinen im Quintett im zweiten Akt «Wie? Wie? Wie? An diesem Schreckensort?» unabhängig kämpfend in den Tempel eingedrungen zu sein, um Tamino zu warnen, sind aber zugleich Gegenstand der ersten Prüfung, die Sarastro dem Prinzen auferlegt, also Instrument des Prüfers. Die Liste der Fragwürdigkeiten liesse sich beliebig verlängern.
An Erklärungsversuchen dieser Ungereimtheiten leidet die Interpretationsgeschichte der Zauberflöte nicht: Man hat Emanuel Schikaneder (zu Unrecht) als tumben Urheber des Librettos ausgemacht. Man hat eine Bruchtheorie aufgestellt, derzufolge Mozart und Schikaneder die Tendenz ihrer Oper mitten im Kompositionsprozess umgekehrt haben, um sich von einem allzu ähnlichen Singspiel abzusetzen, das kurz vor der Zauberflöte in Wien auf die Bühne gekommen war. Papieranalysen der Manuskripte haben diese Theorie widerlegt. Den jüngsten Interpretationsversuch hat mit grossem Aufwand der Ägyptologe Jan Assmann in seinem 2006 veröffentlichten Buch über die Zauberflöte unternommen, in dem er die Oper als ein alle Handlungsebenen und sogar das Publikum miteinbeziehendes freimaurerisches Mysterienspiel deutete, in dem die vermeintlichen dramaturgischen Widersprüche in Wahrheit als raffinierte Täuschungsmanöver und Illusionsstrategien angelegt seien. An der aus der Spur kippenden Ur-Vitalität der Zauberflöte, an der lustvollen Unordnung, die ihr innewohnt, geht freilich auch Assmanns Theorie völlig vorbei. Mozart und Schikaneder waren eben keine Mysterien-Spielmeister, die sich am Reissbrett ein hochgerüstetes, in sich stimmiges Ritual ausgedacht. Ihre Oper dreht sich zwei Akte lang als ein herrlich buntscheckiges, alle Sinne betörendes Kaleidoskop, in dem der offene Montagecharakter theatralische Energien freisetzt und das Nichterklärbare als Moment der Freiheit und des Spasses wirkt.
Daran kann auch nichts ändern, dass Sarastro in der Oper das Schlusswort hat und mit dem Finalchor seine Weltsicht scheinbar ins Recht setzt. Aus seinem Blickwinkel wird das Stück bis heute gerne betrachtet. Tief sitzt in den Köpfen der Zauberflöten-Bewunderer nach wie vor die Sehnsucht, das Stück in seinen Widersprüchen zu glätten, ins Humanistische zu veredeln oder ins rein Märchenhafte abzumildern.
Sarastro liebt die heilige Ordnung. Sein Verstand sagt ihm, dass das Leben besser ist, wenn es nach Regeln geführt wird. Die Vernunft lehrt ihn, dass das Dasein auf Prinzipien beruhen muss. Er findet Ordnung nicht nur notwendig, sondern auch schön und deshalb betätigt er sich als ein Weltbaumeister der geregelten Verhältnisse. Ein Fundament hat er in die Erde eingelassen, das er Tugend nennt, und eine hohe Kuppel darüber errichtet, die er Wahrheit nennt. Viel Zement rührt er in seine Ideale, damit auch ja nichts bröckelt. In Sarastros heiliger Halle des wohlgeordneten Lebens ist alles an seinem Platz: Es gibt Eingeweihte (drinnen) und Nichteingeweihte (draussen), Mann (hoch droben) und Weib (in gebührendem Abstand darunter), Gerechtigkeit und Menschenliebe (auf dem Marmorsockel), Willkürherrschaft, Gewalt und Heuchelei (unter dem Teppich). Es ist ein perfektes Menschheitszuhause. Aber nicht die Welt und die Weltsicht, aus der heraus Mozart seine Zauberflöte geschrieben hat.
Stellen wir uns vor, der kleine Mann im rotem Rock mit den hervorstehenden Augen käme in Sarastros Reich zu Besuch. Gegensätzlichere Charaktere kann man sich kaum vorstellen: Hier der gesetzte Machtmensch und dort die personifizierte Unruhe. Hier der salbungsvolle Redner, der alles zweimal sagt, und dort das sprunghafte Genie, das seinem Gegenüber immer fünf Gedankengänge voraus ist. Der eine ein humorfreier Tugendwächter und Prinzipienreiter, der andere ein Luftikus. In ihrer Beziehung zur Aussenwelt unterscheiden sie sich diametral. Sarastro pflegt ein Verhältnis zur Welt, das auf Exklusion basiert. Er spaltete ab und schliesst aus, was nicht zu seinen Prinzipien passt und seine Ordnung stört. Mozarts Kreativität demgegenüber ist inklusiv, sie öffnet sich der Welt und nimmt als Kraftquelle alles wahr und in sich auf. Wahrscheinlich würden sie sich nicht sehr gut verstehen und sich gehörig auf die Nerven gehen. Womöglich würde Sarastro diesen Mozart, wie es seine Art ist, kuzerhand vor die Tür setzen. Aber zum Glück ist ja Mozart der Komponist der Oper und Sarastro nur eine Figur, die am Ende des ersten Akts die Bühne betritt.
Das Aufgeräumte steht gegen das kreative Chaos, das Geradlinige gegen das lustvoll Gezackte, die geschlossene Kuppel einer idealistisch geformten Welt gegen den offenen Sternenhimmel der Natur. Darum geht es in der Zauberflöte. Und wir kommen ihr näher, wenn wir versuchen, sie mit Mozarts Augen zu betrachten.
Ein Essay von Claus Spahn.
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 24, November 2014.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Dies Bildnis ist bezaubernd schön
Tamino, 1. Akt
Ein Gespräch mit Tatjana Gürbaca und Claus Spahn
Wie machen Sie das, Herr Bogatu?
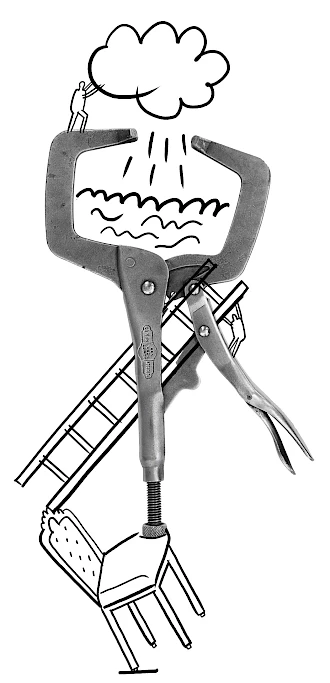
Das Bühnenbild der Zauberflöte: Auf der Drehscheibe stehen in einem Karree vier über Eck gestellte, vollkommen identische Hausfassaden mit je einer Tür in der Mitte, einem Fenster links und einem rechts. Darüber in zwei weiteren Geschossen vier weitere Fenster. Wobei «Fenster» der falsche Begriff ist: Es sind tote Fensterhöhlen, die in den Zuschauerraum starren – denn hinter den Öffnungen ist das Nichts. Unser technischer Projektleiter Moritz Noll hatte die Aufgabe, die Wände so zu konstruieren, dass sie sich nur gegenseitig abstützen. Keine Stützen, keine Zwischenböden und kein Dach dürfen den Lichteinfall von oben in das Haus beeinträchtigen. Und solange die Regisseurin Tatjana Gürbaca die Rollos, die hinter jedem Fenster versteckt in den Fassaden untergebracht sind, nicht schliessen lässt, fällt dieses Licht durch die Fensteröffnungen wieder auf die Bühne – und trifft dort auf Hühner, die neben einem Baum und einem lodernden Lagerfeuer picken und scharren.
Bei dem Baum handelt es sich um ein realistisch nachgebautes Skelett einer Buche, das bis in schwindelnde Höhen beklettert werden kann. Dazu ist es aus zahlreichen gebogenen und geraden, unterschiedlich dicken Stahlrohren zusammengeschweisst und anschliessend durch eine plastische dicke Rinde und entsprechende Farbe in eine Buche verwandelt worden. Sobald die Scheibe dreht, erkennt der Zuschauer, dass vor jeder Fassade ein vollkommen identischer Baum steht. Im Gegensatz zu den Bäumen könnten zwei der Hühner echt sein. Diese sind im Spätsommer geschlüpft und wurden von klein auf von einem Tiertrainer auf ihre Rolle in dieser Inszenierung einstudiert. Die restlichen Hühner hat die Theaterplastik so realistisch nachgebaut, dass es dem Zuschauer erst nach einer Weile auffallen wird, dass es sich nicht um lebendige Tiere handelt. Wenn sich nun aber während der Proben herausstellen sollte, dass die echten Hühner trotz allem Training dazu neigen, suizidal in die Lagerfeuer oder in den Orchestergraben zu springen, werden diese durch weniger eigenwillige Hühnerroboter ersetzt, damit die echten noch ein langes, erfülltes Leben abseits des Rampenlichtes haben.
Der Sprung ins Lagerfeuer würde ihnen allerdings gar nicht schaden, da das Feuer in Wirklichkeit Wasser ist: In jedem Lagerfeuer hat die Requisite mehrere ferngesteuerte Ultraschallvernebler eingebaut, die Wasser in einen sehr feinen Nebel verwandeln. Dieser Nebel wird von unten rotgelblich beleuchtet und hochgeblasen. Da die feinen Wassertropfen in der Luft schnell verdunsten, entsteht der Eindruck von züngelnden Flammen – Flammen allerdings, die nicht in der Lage sind, Hühner in Poulet zu verwandeln.
Text von Sebastian Bogatu.
Illustration von Anita Allemann.
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 24, Dezember 2014.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Auf dem Pult

Die Zauberflöte habe ich mit acht Jahren kennengelernt, als mir mein Vater zu Weihnachten eine Schallplatte schenkte. Ich erinnere mich noch gut: Ich hörte die Platte, während meine Eltern in die Kirche gingen, und war so in die Musik vertieft, dass ich nicht merkte, als sie wieder zurückkehrten. Eine Stelle hat mich schon damals tief berührt: die Fuge am Ende der Oper. Es ist eine sehr archaische Stelle, die in ihrer Strenge an eine Bach-Fuge aus dem Wohltemperierten Klavier erinnert: Pamina und Tamino werden gleich ihre letzte Prüfung bestehen müssen. Obwohl die Fuge in c-Moll steht, hat sie etwas Tröstliches. Nach den vielen Turbulenzen in dieser Oper, der Rachearie der Königin der Nacht zum Beispiel, kommt plötzlich diese Beruhigung, die fast heilig klingt. «Der, welcher wandert diese Strasse voll Beschwerden / Wird rein durch Feuer, Wasser, Luft und Erden», singen die beiden Geharnischten in Anlehnung an einen Lutherchoral. Es ist auch ein Appell an uns, sich den Herausforderungen des Lebens zu stellen, sie beherzt anzugehen und daraus als neuer, gereifter Mensch hervorzugehen. Genial finde ich, wie Mozart hier aus den Staccato-Achteln, die das mutige Wandern beschreiben, und mit den Seufzermotiven, die erst langgezogen, dann verdichtet die ängstliche Erwartung untermalen, eine Fuge komponiert hat, die so bildhaft ist, dass es kaum ein Bühnenbild bräuchte. Mozart löst die düstere Fuge und den Choral dann bald in helles Dur auf. Tamino hört die Stimme von Pamina, es folgt ein fröhliches Allegretto, bei dem sich sogar die beiden Geharnischten in mitfühlende Menschen verwandeln. Bei Mozart ist immer alles gleichzeitig da, Helles, Dunkles, Tiefes und Kindliches. Und nie ist etwas zuviel. Die Zauberflöte gehört zu den Opern, die ich mit Abstand am häufigsten gespielt habe. Ich entdecke aber jedes Mal Neues, und ich freue mich immer wieder darauf, diese Oper zu spielen, nicht zuletzt wegen dieser Fuge.
Zwischenspiel, 15. Juni 2020
Thomas Erlank – Ihm gehört die Zukunft
Der südafrikanische Tenor Thomas Erlank war Mitglied des Internationalen Opernstudios. In unserer Podcastfolge mit Fabio Dietsche spricht er zusammen mit der französischen Mezzospranistin Katia Ledoux über die Ausbildung in Zürich und seine Prägungen, was ihm in seinem Künstlerleben wichtig ist und was er sich erhofft. Beide singen unter anderem live Lieder von Gabriel Fauré und Franz Schubert. Zum Podcast
Die geniale Stelle
Im Libretto von Mozarts Zauberflöte findet sich im Übergang zur letzten Szene eine seltsame Regieanweisung. In der vorletzten Szene hat die Königin der Nacht versucht, mit ihren Helfershelfern heimlich in den Tempel einzudringen, den Siebenfachen Sonnenkreis zu stehlen und so den Machtkampf mit Sarastro für sich zu entscheiden. Dieser Raubversuch wird (vermutlich durch den Einsatz dieser Wunderwaffe) vereitelt, und die Mächte der Finsternis sind vernichtend geschlagen. Dann heisst es im Text: «Sogleich verwandelt sich das ganze Theater in eine Sonne.»
Selbst wenn man berücksichtigt, dass mit dem Wort «Theater» hier natürlich nicht das gesamte Gebäude einschliesslich des Zuschauerraums gemeint ist, sondern nur der sichtbare Bereich der Bühne, bleibt der Eindruck, dass der Autor hier jedes Mass verloren hat und die Möglichkeiten des Theaters vollkommen überschätzt. Das erscheint umso rätselhafter, wenn man bedenkt, dass Emanuel Schikaneder einer der erfolgreichsten und erfahrensten Theatermänner seiner Zeit war, also ein Mann, der sehr wohl wusste, was die Maschinerie des Theaters zu leisten imstande ist und wo ihre Grenzen liegen. Wie ist eine solche Fehlleistung möglich, und warum wurde der offensichtliche Irrtum nicht wenigstens nachträglich korrigiert?
Die Sache wird nicht besser, wenn man sich klarmacht, dass Schikaneder nicht der einzige Theaterautor ist, der dem Theater offensichtlich unlösbare Aufgaben stellt. Verglichen mit dem gigantischen Untergangs- und Wiedergeburtsspektakel, das Richard Wagner für den Schluss der Götterdämmerung vorgeschrieben hat, nimmt sich dieser Fall geradezu bescheiden aus. Es ist darum auch nur folgerichtig, dass Wagner, mit der Dürftigkeit der Bühnenverwirklichung seiner Visionen konfrontiert, auf den Gedanken kam, das «unsichtbare Theater» zu erfinden, das dem Zuschauer die Vision des Dramatikers unmittelbar vor das innere Auge stellen kann, und nicht Pappe und bemalte Leinwand vor das äussere.
Aber dem mit allen Wassern gewaschenen Theater- und Geschäftsmann Schikaneder dürften solche hochgestochenen Gedanken an ein Theater jenseits des Theaters vollkommen fremd gewesen sein. Er schrieb für das ganz diesseitige, ganz sichtbare Theater, und in diesem wollte er seinem Publikum etwas bieten, womit er ganz diesseitiges Geld verdienen konnte. Freilich wusste er als erfahrener Theatermann auch sehr genau, dass es nicht die Aufgabe des Autors ist, die technische Realisierung der Vorgänge zu bedenken. Was er verfasst, die dramatische Vorlage (der Text und/oder die Komposition) ist nicht die Blaupause der Inszenierung, die das Theater nur noch nachzuzeichnen hätte. Ja, sein Werk ist nicht einmal Theater, sondern Dichtung, ein poetischer Text, der dem Theater übergeben wird, damit dieses sein Eigenes daraus macht: das eigenständige, einzigartige, unwiederholbare und nicht konservierbare Theaterkunstwerk.
So schrieb Schikaneder nieder, was ihm der treffendste Ausdruck für den Vorgang schien: Die Mächte der Finsternis sind vernichtet, das strahlende Licht der (für ihn selbstverständlich männlichen) Weisheit und der (für ihn ebenso selbstverständlich männlichen) Humanität herrscht unumschränkt – auf eine knappe Formel gebracht: «Das ganze Theater verwandelt sich in eine Sonne.» Die Frage, wie das zu realisieren sei, hat der Librettist Schikaneder dem Theaterdirektor Schikaneder überlassen: Der Dichter träumt das Unmögliche, das vielleicht doch nur das vorläufig Unmögliche ist. Wer weiss denn, ob es nicht einmal möglich sein wird, das ganze Theater in eine Sonne zu verwandeln? Und vielleicht ist es dann ja doch das ganze Gebäude, das sich in eine gewaltige Lichtquelle verwandelt, von der ein Leuchten ausgeht, das weit hinausreicht in die Welt ausserhalb der «fensterlosen Häuser» (wie Bertolt Brecht die Theater genannt hat) und sie erleuchtet und verwandelt. Die Kunst, daran scheint uns Schikaneders unrealisierbare Regieanweisung zu gemahnen, ist der Raum des Traums vom Unmöglichen, von der unmöglichen Bühnenverwandlung ebenso wie vom endgültigen Sieg des Guten in der Welt.
Text Werner Hintze.
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 24, Dezember 2014.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Die Zauberflöte
Synopsis
Die Zauberflöte
Erster Aufzug
Bedroht von einer Schlange ruft Tamino verzweifelt um Hilfe. Drei Damen aus dem Reich der Königin der Nacht retten ihn, bewundern die Schönheit des jungen Mannes und verschwinden wieder. Tamino bleibt alleine zurück, ist verwirrt über das gerade Erlebte, hört jemanden und versteckt sich. Papageno erscheint, der Vögel für die Königin der Nacht fängt und sich nach einem Mädchen sehnt. Er prahlt vor Tamino damit, die Schlange getötet zu haben. Die drei Damen bestrafen Papageno für diese Lüge - er bekommt ein Schloss vor den Mund. Tamino zeigen sie ein Bild von Pamina, der Tochter der Königin der Nacht. Tamino verliebt sich in das Bild.
Die Königin der Nacht tritt auf. Sie verspricht Tamino die Hand ihrer Tochter Pamina, wenn er sie aus dem Reich des Bösewichts Sarastros zurückholt. Die drei Damen nehmen Papageno das Schloss vom Mund, er soll Tamino auf seiner Mission begleiten. Die Damen geben den beiden eine Zauberflöte und ein Zauber-Glockenspiel mit auf den Weg und kündigen an, drei Knaben würden ihnen den Weg weisen.
Der Aussenseiter Monostatos hat Pamina in seiner Gewalt und bedroht sie. Papageno findet Pamina, erkennt sie und erzählt ihr von Tamino, dem Prinz, der sich in sie verliebt habe und unterwegs sei, sie zu retten. Pamina und Papageno stellen fest, dass sie den Glauben an die Liebe teilen: «Wir leben durch die lieb' allein.» Die drei Knaben haben Tamino zu Sarastros Haus geführt. Dort trifft er einen Sprecher, der ihn in seinem Hass auf Sarastro verunsichert. Stimmen aus dem Haus verkünden, dass Pamina noch lebt. Aus Freude darüber spielt Tamino auf seiner Zauberflöte und wilde Tiere erscheinen.
Pamina und Papageno wollen fliehen und werden von Monostatos erwischt. Papageno bannt die Gefahr mit seinem Glockenspiel. Das Volk kündigt Sarastro an, den «göttlichen Weisen», «dem alle sich weihn.» Pamina tritt vor Sarastro und rechtfertigt sich. Sarastro will ihr die Freiheit dennoch nicht geben. Monostatos bringt Tamino zu Sarastro. Tamino und Pamina sehen und umarmen sich. Sarastro lässt Monostatos bestrafen und bestimmt, Tamino und Papageno in den Prüfungstempel zu führen.
Zweiter Aufzug
Sarastro erklärt, Tamino in den Kreis der Eingeweihten aufzunehmen. Während Tamino sofort bereit ist, sich den Aufnahmeprüfungen zu unterziehen, lässt sich Papageno nur mit der Aussicht auf ein Mädchen überreden. Als erste Prüfung wird den beiden das Verbot auferlegt, mit Frauen zu sprechen. Als die drei Damen erscheinen, um Tamino und Papageno zu verführen, versuchen die beiden standhaft zu bleiben, Tamino gelingt das besser, Papageno weniger.
Monostatos schleicht zu Pamina und beklagt, dass sie ihn, den Aussenseiter, nicht liebt. Dann sucht die Königin der Nacht ihre Tochter auf. Sie erzählt Pamina, dass ihr greiser Ehemann den mächtigen Sonnenkreis auf dem Sterbebett an Sarastro weitergegeben und sie als Erbin übergangen habe. Pamina soll Sarastro töten. Monostatus bedrängt Pamina erneut. Sarastro geht dazwischen und erklärt, dass man in seinem Reich die Rache nicht kenne, schränkt aber ein: «Wen solche Lehren nicht erfreu'n, verdienet nicht ein Mensch zu sein.»
Tamino und Papageno haben weiterhin Sprechverbot. Aber Papageno plaudert mit einem verkleideten Mädchen, das ein Auge auf ihn geworfen hat. Bevor Papageno erfährt, wer sie ist, verschwindet sie wieder. Die drei Knaben geben Tamino und Papageno die Zauberinstrumente wieder, die man ihnen abgenommen hatte. Pamina findet Tamino, aber der wendet sich stumm ab von ihr. Pamina verfällt in tiefe Traurigkeit und sehnt den Tod herbei.
Sarastro führt Tamino und Pamina zusammen, auf dass sie sich das letzte Lebewohl sagen. Papageno ist für die Eingeweihten ein aussichtsloser Fall. Er wünscht sich nur «ein Mädchen oder Weibchen». Dies erscheint auch, verschwindet aber erneut. Die drei Knaben halten Pamina vom Selbstmord ab.
Von zwei Geharnischten werden Pamina und Tamino zur lebensbedrohlichen Feuer- und Wasserprobe geführt. Sie überleben sie. Papageno kann sein Mädchen nicht finden und beschliesst seinem Leben ein Ende zu setzen. Er hofft auf Hilfe. Vergeblich. Da erscheinen die drei Knaben und erinnern ihn an die Zauberglöckchen. Er spielt sie und tatsächlich, Papagena erscheint.
Die Königin der Nacht, die drei Damen und Monostatos dringen noch einmal in Sarastros Tempel ein, werden aber «zerschmettert und zernichtet». Die Strahlen der Sonne vertreiben die Nacht.