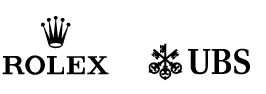Geschichte
Kurze Geschichte des Opernhauses Zürich
Die Geschichte des Opernhauses Zürich geht zurück auf das 1834 mit Mozarts «Zauberflöte» eröffnete «Actien-Theater». Es war das erste stehende Theater der Stadt und wurde von theaterbegeisterten Bürgern in Form einer Aktiengesellschaft gegründet. Die Aktiengesellschaft (heute Opernhaus Zürich AG) ist nach wie vor Trägerin der Institution; im November 2009 wurde ihr 175-jähriges Jubiläum gefeiert. Haupt-Subventionsgeber ist seit 1995 der Kanton Zürich.
Das alte «Actien-Theater» brannte 1890 ab und wurde durch einen von Fellner und Helmer entworfenen Neubau ersetzt. Auch das neue Theater, unweit des Bellevue am Zürichsee gelegen, wurde fast vollständig privat finanziert. Es wurde 1891 mit Wagners «Lohengrin» unter dem Namen «Stadttheater» eingeweiht. Seit 1921 gehen Musiktheater und Schauspiel in Zürich getrennte Wege. Seit 1964 heisst das alte «Stadttheater» Opernhaus.
Das heute ca. 1'100 Zuschauer fassende Theater wurde 1982-1984 umfassend saniert und bekam einen Erweiterungsbau am Uto-Quai, in dem auch eine Studiobühne als zweite Spielstätte untergebracht ist. 1985 wurde das Opernorchester vom Tonhalle-Orchester getrennt und damit die Philharmonia Zürich ins Leben gerufen. Seit 1995 existiert ein eigenes Barockensemble («La Scintilla»), das sich aus den Reihen des Opernorchesters gebildet hat.
Hier finden Sie die Festschrift zum 175-jährigen Jubiläum der «Theater-Actiengesellschaft» aus dem Jahre 2010.
Die Aktie
«Es brennt, es brennt! Das Theater brennt!» – «Und ich dachte schon, das gehört zum 2. Akt?!»
Keine Verletzten, alle sind erleichtert. Aber vor allem darüber, dass es brennt. Das Theater, hier in Zürich, 1890. Erleichtert? Wollten die Bürger etwa kein Theater mehr? Oder wollten sie eigentlich schon ein Theater, aber nicht dieses und haben es deshalb angezündet?? Nein, haben sie nicht. Aber sie hatten dafür eine viel bessere, zündende Idee... In Episode 8 gehen wir dem Gründungsmythos der Opernhaus Zürich AG auf den Grund.

Kreidebleich soll Theaterpräsident Kisling gewesen sein, als er am 1. Januar 1890 inmitten der Vorstellung im Zürcher Aktientheater auf die Bühne trat und das Publikum aufforderte, das Gebäude ruhig, aber zügig zu verlassen. Draussen trauten die Theatergäste ihren Augen kaum. Das Theater stand lichterloh in Flammen! Bange Minuten verstrichen, bis der Theaterpräsident als letzter «unter dem Hagel der fallenden Dachziegel» (NZZ) ins Freie gelaufen kam. Immerhin vermeldete er, dass weder Tote noch Verletzte zu beklagen seien.
So dramatisch der Theaterbrand war, so nüchtern fielen die Zeitungskommentare dazu aus. «Nun ist der alte Kasten tot. Wir danken dir, Herr Zebaot», dichtete der Schreiberling des Schweizer Illustrierten Extrablattes. Es war ein offenes Geheimnis, dass das alte Aktientheater, untergebracht in einem ehemaligen Kornspeicher an der «Untern Zäunen», den repräsentativen Bedürfnissen des Zürcher Bürgertums nicht mehr genügte. Bereits 1879 hielt eine von der Theater AG eingesetzte Kommission zur Prüfung eines Theaterneubaus fest, «dass das gegenwärtige Theater mit Rücksicht auf seine Lage, Zugänglichkeit, Ausdehnung und innere Ausstattung bei weitem nicht mehr der Entwicklung Zürichs, der Verschiebung seiner geschäftlichen Mittelpunkte und, es sei offen gesagt, seiner geistigen Bedeutung entspricht». Zehn Jahre später, 1889, schlugen die Zürcher Architekten Chiodera und Tschudy in ihrem Essay «Zur Tonhalle und Theaterfrage» einen monumentalen Neubau vor, der sowohl der Theater AG als auch der Tonhallegesellschaft als neues Heim dienen sollte. Allein die Finanzierung war umstritten: Während die Theater AG immer vehementer ein finanzielles Engagement der Stadt forderte, sah diese keinen Grund für eine staatliche Einmischung in kulturelle Angelegenheiten.
Zürich ohne Theater
Diese Pattsituation änderte sich mit dem Theaterbrand auf einen Schlag. «Heute steht Zürich vor der Tatsache, dass es kein Theater besitzt» – so der nüchterne Kommentar des Stadtrates. Die Theaterfreunde erkannten die Chance, den Druck auf die Behörden zu erhöhen. Zürich brauche ein Theater, schrieb ein Redakteur der Neuen Zürcher Zeitung, und sei ohne diese Kunstanstalt gewissermassen dekapitalisiert und zu dem Range eines Provinzialstädtchens herabgesunken. Am 5. Januar 1890 wurde die so genannte Theaterfrage sogar zur Glaubensfrage, als der populäre Pfarrer Wissmann in der St. Peterskirche zur Predigt «Das Theater im christlichen Volke» ansetzte und dabei auf die Gemeinsamkeiten zwischen kunstvollem Theater und Christentum hinwies: Beide dienten letztlich der «Veredlung des menschlichen Geschlechts».
Einen Tag nach der Predigt verschickte der Vorstand der Theater AG eine Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung. Am 18. Januar 1890 traf man sich im Zunfthaus zur Zimmerleuten, wo die Aktionäre dem Vorstand einstimmig die Vollmacht erteilten, mit den städtischen Behörden über einen «Bauplatz und entsprechende Subventionen» zu verhandeln. Treibende Kraft des Theatervorstands war Robert Schwarzenbach, dazumal einer der mächtigsten und reichsten Seidenfabrikanten der Welt. Von einem Theaterprovisorium im Börsensaal wollte er nichts wissen, das würde nur der endlich entflammten Theaterfrage den Sauerstoff entziehen. Dafür versprach er den Aktionären bis spätestens zur Spielzeit 1891/92 ein neues Theater. Um den ambitionierten Zeitplan einzuhalten, musste die Theater AG nun rasch drei Hürden nehmen: die Finanzierung klären, einen Standort finden sowie den passenden Architekt.
Die Finanzierungsfrage war heikel. Natürlich hätte die Theater AG den Konkurs beschliessen und die Ära des privat geführten Theaters in Zürich beenden können. Doch das wäre kaum im Interesse der Theateraktionäre gewesen. Schliesslich garantierte das privat organisierte Theater auch Privilegien: Die Aktionäre hatten pro Aktie das Mietrecht auf zwei Plätze in der Galerie oder in den Logen sowie das Vorzugsrecht bei der Auswahl der Abonnementsplätze. Auch deshalb kündigte der Vorstand 1890 an, nur die Theater AG selbst dürfte die Initiative zum Theaterneubau ergreifen. Das nötige Geld sollte durch eine Erhöhung des Gesellschaftskapitals von 116.000 Franken auf 1,5 Millionen Franken beschafft werden. Dazu mussten neben den bestehenden 250 Theateraktien 750 neue mit einem Nominalwert von 1500 Franken gezeichnet werden. Das entsprach damals dem doppelten Jahresgehalt eines Seidenwebers in einer von Robert Schwarzenbachs Fabriken. Zwar richtete sich die Emission nicht an Proletarier, doch selbst für gut situierte Bürger waren 1500 Franken happig. Deshalb forderten einige Aktionäre, den Preis auf 500 Franken zu reduzieren – vergeblich. Die Mehrheit der Theater AG wollte keine unnötig breite Abstützung im Aktionariat. Schliesslich wäre die Theaterleitung bei einer Emission von 3000 Aktien «auf unübersteigliche Schwierigkeiten gestossen in der Ausübung der eingeräumten Vorrechte bei der Bewerbung um Plätze für die Theatervorstellungen».
Es folgte die Ernüchterung: Zwei Tage vor Ende der Zeichnungsfrist hatten erst 190 Personen 500 Aktien gezeichnet, so dass die Theater AG die Ausschreibung um zwei Wochen verlängern musste. Spott erreichte Zürich aus der Provinz: «Zürich steht vor der beschämenden Tatsache, dass es, einem Notschrei der Theatergesellschaft nach dem andern zum Trotz, kaum die 750 Aktien zu 1500 Franken zusammenbringt, ohne deren Zeichnung von einem Bau keine Rede sein kann», schrieb die Neue Glarner Zeitung. «Zürich will Grosstadt sein und bringt nicht einmal ein Schauspielhaus wie Basel – geschweige denn wie Genf zustande.» (NZZ 18.4.1890) Das war allerhand aus dem Glarnerland. Eine Woche später waren alle 750 Aktien gezeichnet.
Die Theaterplatzfrage
Nachdem die Aktienemission erfolgreich über die Bühne gegangen war, stellte sich die Frage nach dem Standort des Musentempels. Und nun kam die Theater AG nicht mehr an der Stadt vorbei, denn nur diese verfügte über Landreserven für einen freistehenden, repräsentativen Bau. Der Stadtrat hiess das Gesuch der Theater AG gut mit der Begründung, die Stadt dürfe als eifrige Dienerin der Künste die Hände nicht sinken lassen, wenn es gelte, der Musik und der Schauspielkunst eine unentbehrliche Stätte der Betätigung einzuräumen. Das genügte vorerst, um die Theaterplatzfrage in die Öffentlichkeit zu tragen. Nachdem eine erste romantische Idee aus Theaterkreisen, das neue Haus einer Akropolis gleich auf dem Lindenhof zu errichten, fallengelassen worden war, blieben zwei realistische Bauplätze: der Heimplatz, wo heute das Kunsthaus steht, und der Dufourplatz am Utoquai.
Nun begann ein Wettbieten zwischen den angrenzenden Ausgemeinden, die sich von einem Theaterbau in ihrer Nähe wirtschaftliche Vorteile erhofften. Das erkannte der Stadtrat, der der Gemeinde Riesbach im März 1890 unverblümt mitteilte, dass im Falle der Annahme dieses Platzes «von Seite Riesbachs eine ökonomisch Entschädigung gewärtigt» würde. Prompt beschloss der Gemeinderat Riesbach, der Stadt Zürich eine Subvention von 50.000 Franken zu zahlen, sofern das Theater auf dem Dufourplatz gebaut würde. Davor hatte sich bereits Enge zu einer Subvention von 25.000 Franken verpflichtet. Hottingen und Fluntern boten zusammen «nur» 45.000 Franken. Das Stadtzürcher Parlament entschied sich für den Dufourplatz.
Am 20. Mai 1890 traf sich die Theater AG mit städtischen Beamten zu Vertragsverhandlungen. Da es sich bei der Schenkung des Grundstücks und der Übernahme der Tiefbauarbeiten um öffentliche Werte von immerhin rund 400.000 Franken handelte, wollte die Stadt die Leistungen an Bedingungen knüpfen. Sie verlangte von der Theater AG, ein vom Stadtrat bezeichnetes Mitglied in ihren neunköpfigen Vorstand auf zunehmen. Zudem wollte Gemeinderat Bodmer die Theater AG dazu zu verpflichten, «alle 14 Tage Vorstellungen gediegenen Inhaltes, seien es Opern oder Schauspiele, zu ermässigten Preisen abhalten zu lassen». Dadurch würde das Theater auch denjenigen Bevölkerungsschichten Zürichs geöffnet, die sich bislang kaum einen Theatereintritt hatten leisten können. Der Antrag wurde im Gemeinderat abgelehnt.
Theaterarchitektur ab Stange
Eine «ungewöhnlich belebte Diskussion» (NZZ) entfachte sich im Mai 1890 bei einer Veranstaltung des Zürcher Ingenieur und Architektenvereins. Es war publik geworden, dass die Theater AG bereits zwei Wochen nach dem Theaterbrand zwei Wiener Architekten mit dem Neubau des Theaters beauftragt hatte – sehr zum Unmut der einheimischen Architektengilde. Warum hatte es keine öffentliche Ausschreibung gegeben? Stadtpräsident Pestalozzi hatte einige Wogen zu glätten: Natürlich habe die städtische Baukommission eine Konkurrenz gewünscht, jedoch sei die Stadt in diesem Fall nicht Bauherrin, sondern die Theater AG. Eine Ausschreibung hätte zudem das Bauprojekt verzögert. Unterstützt wurde Pestalozzi vom Architekten Gull, der den einheimischen Architekten ohnehin das für die Erbauung eines Theaters notwendige Knowhow absprach.
Das liess sich von den beiden Wiener Architekten Fellner und Helmer nicht behaupten. Zu dem Zeitpunkt, als die Theater AG sie mit dem Bau beauftragte, hatten Fellner und Helmer bereits 17 Theater und Opernhäuser in ganz Europa gebaut. Sie waren regelrechte Theaterkonfektionäre. Dass die beiden erfolgsverwöhnten Architekten 1889 den Wettbewerb für einen Theaterneubau in Krakau verloren, entpuppte sich für die Theater AG als Glücksfall. Es reichten einige Änderungen am bestehenden Entwurf, um das für Krakau geplante Bauwerk an die Zürcher Bedürfnisse anzupassen.
Die Mäzene verewigen sich
Die Finanzierung der Bauarbeiten hatte etwas Symbolisches: Während die Stadt mit den öffentlichen Geldern die aufwändigen Tiefbauarbeiten im feuchten Morast finanzierte, bezahlte die Theater AG das eigentliche Bauwerk. Und den grossbürgerlichen Mäzenen schliesslich war die Ausschmückung des Theaters mit Putten, Fresken und Figuren vorbehalten. So konnten die Leserinnen und Leser der Festschrift zur Eröffnung des Stadttheaters wenig später lesen, dass die beiden neoklassischen Figuren links und rechts der Eingangstreppe «ein beredtes Zeugnis der Generosität des Herrn Bodmer» (Festschrift zur Eröffnung des neuen Stadttheaters in Zürich 1891) waren. Damit nicht genug: Weitere 14.500 Franken spendete das frisch gewählte Vorstandsmitglied zur Ausschmückung des Theaters. Man ahnt es schon: Bodmer von Muralt war wie Vorstandskollege Schwarzenbach «von Beruf: Seidenfabrikant; aus Passion: Theaterverwaltungsrat». Auch die beiden imposantesten Figuren der Hauptfassade, die Dichtkunst und die Musik, gingen auf die Kosten eines «hochherzigen Kunstmäzens, der sich bereits durch seine Beteiligung bei der Aktienzeichnung grosse Verdienste erworben hatte». Kostenpunkt: 20.000 Franken. Und auch die übrigen Verwaltungsräte der Theater AG begnügten sich nicht damit, unentgeltlich 125 Bausitzungen abzuhalten, sondern spendeten gemeinsam die vier Deckengemälde im Auditorium des Stadttheaters für 11.000 Franken. Kleine Randnotiz: Die Kunsthandwerker für die üppigen Gipsarbeiten, die neobarocken Plastiken, Fresken und Vergoldungen fanden die Theateraktionäre nicht in der demokratischen Schweiz, sondern im höfischen Wien.
Epilog
Als das Stadttheater am 30. September 1891 mit einem Festspiel von Carl Spitteler eröffnet wurde, konnte das Zürcher Bürgertum stolz sein. In einem 21 Monate langen Kraftakt hatte es Zürich ein Theaterhaus beschert, das den internationalen Vergleich nicht zu scheuen brauchte. Mit gutem Grund liess die Theater AG die Worte «Durch Bürgergunst geweiht der Kunst» in die Fassade des Seitenflügels meisseln. Zu vier Fünfteln hatten Private den rund 2 Millionen Franken teuren Bau finanziert.
Und das war auch richtig so. Denn ein mehrheitlich über Steuergelder finanziertes Institut hätte bedingt, dass dieses allen Bevölkerungsschichten hätte offen stehen müssen. Davon aber war das Stadttheater 1891 weit entfernt. Eine Opernvorstellung kostete in der Saison 1891/92 zwischen 1 Franken und 6 Franken, ein Theaterstück zwischen 80 Rappen und 5 Franken. Um sich und seiner Gattin einen Abend im Stadttheater zu ermöglichen, hätte ein Fabrikarbeiter damals einen Tageslohn opfern müssen.
So war das Theater am Dufourplatz weit weg von der Welt des gemeinen Volkes. Deren Welt, das waren die Arbeiterquartiere jenseits der Sihl, wo seit 1876 ein ebenfalls monumentales, wenn auch weniger einladendes Gebäude stand: die Kaserne. Hier, in Wiedikon und Aussersihl, feierten die sozialistischen Arbeiter 1890 erstmals in Zürich den 1. Mai. Hauptredner war Robert Seidel, Sozialdemokrat und Chefredakteur der Arbeiterstimme. War es Zufall, dass er just in dem Jahr, in dem die Theater AG so eifrig den Neubau ihres Musentempels plante, in der 1. Mai Rede auf die Kunst und Kultur zu sprechen kam? «Wer liest und versteht unsere Klassiker? Das Volk nicht. Wer geniesst die Kunstschätze? Das Volk nicht.» Warum? «Weil das Volk unter sklavischer Arbeit seufzt und für die Pflege von Kunst und Wissenschaft keine Zeit, keine Kraft und keine Mittel hat.»
Nichts bringt die geistige Entfernung des Stadttheaters zur Kultur der Massen, zu den ersten Massendemonstrationen, zu den übervölkerten Arbeiterquartieren, zu den lärmigen Fabriken, zur «Psychologie der Massen» (Gustave Le Bon) besser zum Ausdruck als das Titelbild der Festschrift zur Eröffnung des Stadttheaters. Das Theater präsentierte sich hier als ein Ort der Wenigen. Als Gegenraum zum Raum der Massen. Jedes Anzeichen von Urbanität wurde ausradiert. Ein Theater auf dem Lande.
Trotzdem: Der Grundstein für eine Theaterpolitik war 1891 gelegt. Seitdem hat die Stadt Zürich jede Erhöhung der Theatersubvention von zwei Dingen abhängig gemacht: Erstens von einer Vergrösserung des staatlichen Mitspracherechts – in Form von Gemeindevertretern im Verwaltungsrat der Theater AG. Zweitens von einer Erhöhung der Vorstellungen zu vergünstigen Preisen, den Volksvorstellungen. Ging die erste Volksabstimmung zur Erhöhung der Theatersubventionen 1901 noch verloren, legitimierten seit 1908 drei erfolgreiche Volksabstimmung jede Subventionserhöhung – bis 1928 die Mehrheit des Verwaltungsrates durch die öffentliche Hand bestimmt wurde. Diese Regelung gilt bis heute sowohl für die Opernhaus Zürich AG als auch für die Schauspielhaus AG. Und wenn sich heute jemand über die immer noch horrenden Eintrittspreise des Opernhauses erhitzt, so kann das Personal an der Kasse beruhigt auf die zahlreichen Volksvorstellungen und Opernhaustage verweisen. Dann ist die Oper nicht teurer als das Kino.
Text von Dr. Christoph Kohler, Historiker und Partner der Widmer Kohler AG.
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 41, September 2016
Das Mag können Sie hier abonnieren